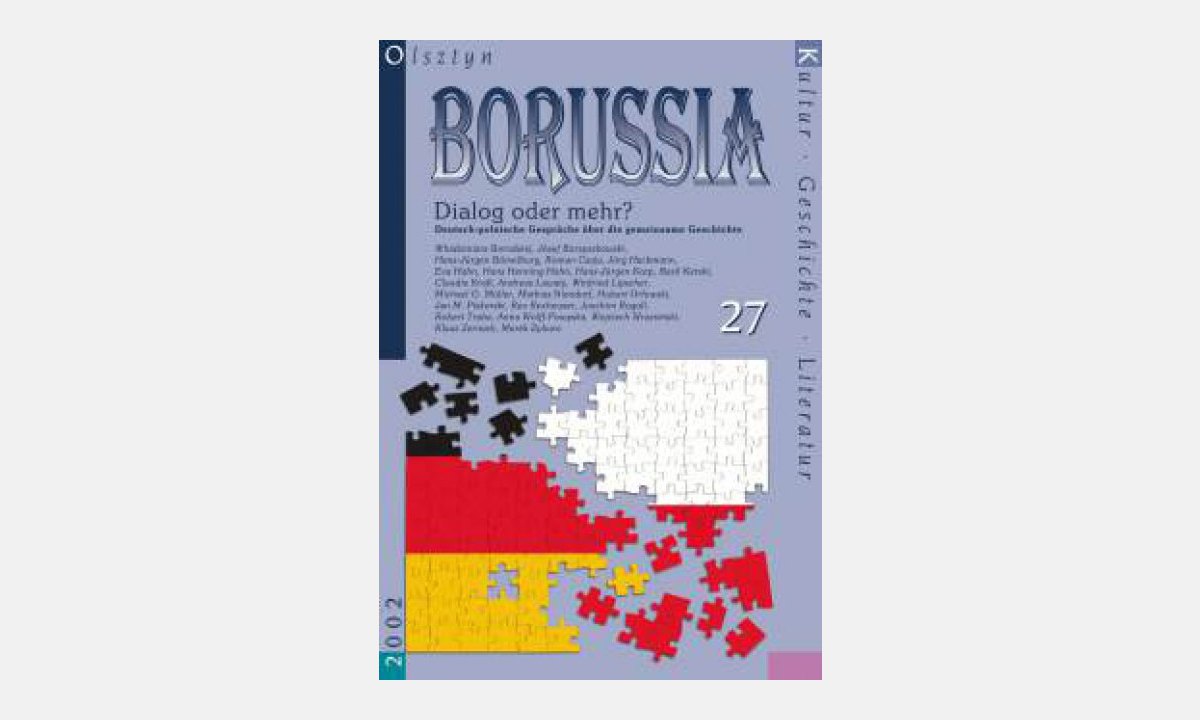Es ist keine Frage, dass auch in dem »irrlichtelierenden« Vergangenheitsbetrieb der Postmoderne, der uns heute umgibt, sich manche unserer historischen Probleme in neuem Licht zeigen. Das müssen wir im Auge behalten.
Wichtiger aber sind für die polnischen und deutschen Historiker die »geschichtspolitischen« Folgen der Epochenwende von 1989/1990. Denn dank dieser wird die Geschichte Polens von ihrer lange geltenden Solidarisierungsfunktion für die polnische Nation entlastet. Seit fast drei Jahrhunderten kann Polen erstmals frei und souverän über seinen politischen Weg entscheiden. Die Unterwerfung unter die Interessen seiner großmächtigen Nachbarn im Osten und im Westen sowie die Nachgeschichte dieser Umklammerung gehören der Vergangenheit an. Die Geschichte Polens und die der polnisch-deutschen Beziehungen öffnen sich hin zu mehr europäischer Normalität. Geschichte wird wieder Geschichte. Dafür gibt es deutliche Anzeichen in der polnischen wie in der polnisch-deutschen Historiker-diskussion der letzten anderthalb Jahrzehnte. Zugleich aber ist nicht zu übersehen, dass die historische Erfahrung der drei Jahrhunderte »negativer Polenpolitik« als tragender Grund der kollektiven Erinnerung noch kraftvoll nachwirkt und weiter nachwirken wird.
Vor diesem Hintergrund versuche ich, Antworten auf die drei von der Redaktion gestellten Fragen zu geben:
Die Redaktion will das »wichtigste Problem« im Verhältnis zwischen den deutschen und polnischen Historikern erkunden. Ich sehe es weiterhin in der Asymmetrie der gegenseitigen Wahrnehmung. Der umfassenden Orientiertheit polnischer Historiker in deutschsprachiger Historiographie steht auf deutscher Seite weitgehend Abstinenz in bezug auf die reiche polnische Produktion gegenüber. Polnisch lernen und lesen in Deutschland weiterhin nur die wenigen Fachleute; eine in die Gesellschaft wirkende Reflexion über die Bedeutung von Sprache und Kultur unseres größten östlichen Nachbarlandes ist auch nach der politischen Wende unter den deutschen Intellektuellen – von wenigen Literaten, Wissenschaftlern und Publizisten abgesehen – nicht in Gang gekommen. Auch der politische Entwurf des »Weimarer Dreiecks« findet keine Abstützung durch eine bildungspolitische Programmatik, die der Geltung Polens im Bildungshorizont der westlichen Partnerländer dienlich wäre. Aber nicht nur die mentalen, auch die praktischen Voraussetzungen dafür sind deprimierend dürftig.
Doch hellt sich das Bild auf, wenn man den Blick auf die historische und kulturwissenschaftliche Forschung und das Interesse der jüngeren Generation daran richtet. Es gibt heute in Deutschland eine beachtliche Zunahme des wissenschaftlich ambitionierten Nachwuchses mit guter polonistischer Zurüstung in Sprache und Landeskenntnis. Dieser trifft in Institutionen wie dem Deutschen Historischen Institut in Warschau, dem Geisteswissenschaftlichen Zentrum für Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas in Leipzig und dem reformierten Herder-Institut in Marburg auf gute Förder- und Kontaktmöglichkeiten. Von den Instituten getragene, aber auch durch Eigeninitiative des Nachwuchses geschaffene Stipendien- und Kooperations programme finden in Polen wie in Deutschland lebhaften Zuspruch.
So scheint in der Tat bei der jüngeren Historikerschaft beider Länder eine »neue Qualität« in der Rezeption der »gemeinsamen Geschichte« im Entstehen zu sein. (Näheres s. unter 2. und 3.)
Dieses festzustellen bedeutet indes nicht, dass nicht auch ältere Positionen weiter im Gespräch sind. Einige haben ja durchaus eine Vorläuferrolle für den Wandel gespielt. Andere sind als Nachzügler der nationalistischen Konfrontation der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu betrachten, – man braucht nur an manche Pendelausschläge der Preußen-Debatte bis heute zu denken.
Die Redaktion fragt nach »methologischen Räumen«, die innovatives Potential enthalten. Sie kommen auf verschiedenen Ebenen der geschichtswissenschaftlichen Interaktion vor – einzelnational, bilateral und multilateral beziehungsgeschichtlich. Ich richte im folgenden den Blick bewußt vor allem auf die älteren Epochen, denn die modernen Jahrhunderte werden in anderen Beiträgen ohnehin stärker zu Worte kommen.
Als signifikantes Beispiel greife ich heraus, welche wertbeständige und zukunftweisende Rolle die Arbeiten des großen Warschauer Mediävisten Benedykt Zientara spielen, obwohl er bereits 1983 gestorben ist. Fast hat man den Eindruck, er habe damals schon für eine neue Epoche geschrieben. Bei den polnischen und deutschen Ostmitteleuropa-Mediävisten haben sich Zientaras Erkenntnisse als Leitfragestellungen erwiesen, von denen weitere Entwicklungen in der Diskussion ausgegangen sind und immer noch ausgehen. Es handelt sich – etwas vereinfacht – um
a) das Problem der frühmittelalterlichen Staats- und Nationsanfänge,
b) die hochmittelalterliche Kolonisation,
c) die Frage nach Polens Westen und Deutschlands Osten als Problem landesgeschichtlicher Forschung.
Das erste Thema ist im Jahr 2000 in dem historischen Jubiläum des Aktes von Gnesen in den deutsch-polnischen Diskussionen vielfach wieder aufgegriffen und weitergeführt worden. Auch die Impulse Gerard Labudas wirken weiter, so in seiner Kontroverse mit Johannes Fried über die erste polnische Königswürde.
An dem zweiten Problem, der hochmittelalterlichen Kolonisation zu deutschem Recht, hat namentlich Jan Piskorski in zahlreichen eigenen Studien und in der Anregung von Dissertationen und internationalen Gesprächen angeknüpft. Er hat Stettin zu dem in dieser Frage heute führenden Forschungszentrum gemacht.
Auf andere Weise hat der Zientara-Schüler Sławomir Gawlas den Faden weitergesponnen, indem er die Frage stellt, warum die Ergebnisse der Kolonisation in Deutschland und Polen so konträr ausgefallen sind, d. h. auf der deutschen Seite zum landesfürstlichen Territorialstaat und in Polen zum Einheitsstaat im wiedervereinigten Königreich geführt haben. Es fragt sich, ob angesichts solcher Unterschiede an der Vorstellung von übereinstimmenden Abläufen und universalen Wirkungskräften der Kolonisation festgehalten werden kann.
Das dritte große auf Zientara zurückgehende Thema – die Landesgeschichte des altpolnischen Westens, der deutscher Osten wurde und heute wieder Polens Westen ist – hat die stärkste Entfaltung als moderne Forschungsrichtung in Polen, Deutschland und in Einzelfällen auch in England und Amerika gefunden. Diese neue Landesgeschichte geht mit ihren Anreizen weit über die Epochengrenzen des Mittelalters hinaus bis in die modernen und aktuellen Probleme z.B. der Grenzregionen. Auf beiden Seiten der Oder sind viele junge Forscher mit solchen Themen beschäftigt. Ein schönes Beispiel allerjüngsten Datums bietet der neueste Band des Nadwarcianski Rocznik Historyczno-Archiwalny (Gorzów Wlkp. 2001).
Alles dieses impliziert schon eine Antwort auf die 3. Frage der Redaktion, die Frage nach dem Generationenwechsel in der Erforschung der Rezeption der deutsch-polnischen Beziehungen. Auch dazu soll – abschließend – ein Beispiel angeführt werden : Mit Jörg Hackmanns materialreicher Untersuchung über Ostpreußen und Westpreußen in den Arbeiten deutscher und polnischer Landeshistoriker (1996) ist ein Grundlagenwerk traditionskritischer Historiographiegeschichte entstanden, das Orientierung gibt für die wachsende deutsch-polnische Zusammenarbeit. Ergänzt wird diese Forschungsrichtung durch personen- und institutionengeschichtliche Untersuchungen zur deutschen »Ostforschung« und polnischen »Westforschung« und ihre politischen »Verstrickungen«. Die Zahl der deutsch-polnischen Initiativen der mittleren und der jüngeren Wissenschaftlergenerationen ist, wie man als Angehöriger der älteren vor allem an der Gutachterei spürt, in ziemlich raschem Wachsen begriffen. Offensichtlich ist das Bewußtsein von der gemeinsamen Zuständigkeit für die Geschichte von Deutschlands Osten und Polens Westen heute keine Illusion mehr. Der alte Satz Richard Roepells, jenes Breslauer Historikers im 19.Jahrhundert, der so viel für die Zusammenführung deutscher und polnischer Geschichtsstudenten am Thema der Geschichte Polens in seinen Seminaren geleistet hat, gewinnt wieder Gültigkeit: Die Wissenschaft trennt die Nationen nicht, sie verbindet sie.