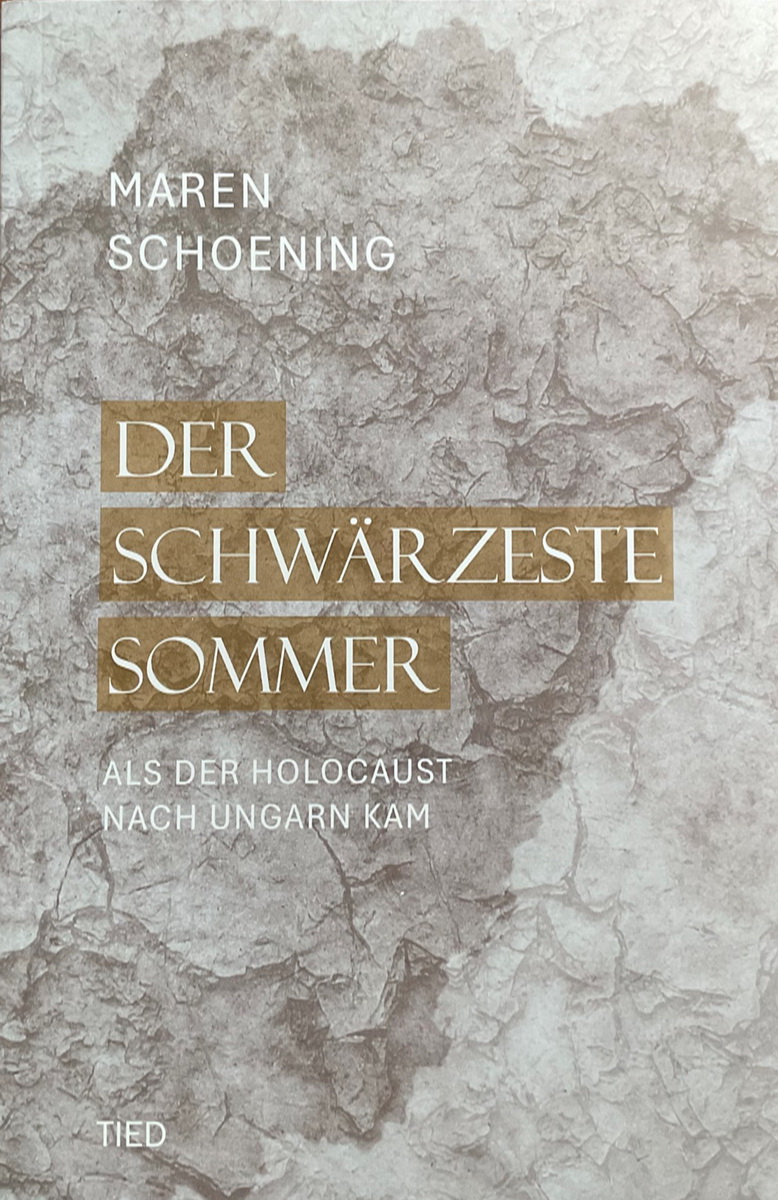 Leopold/Lipót Aschner hatte Arbeiterwohnungen, ein Gebäude mit Kantine, Bibliothek und Veranstaltungsräumen, Schwimm- und Sportanlagen errichten lassen, den Spitzensport sowie das soziale, kulturelle Leben im Stadtteil Neu-Pest/Újpest gefördert – doch am »schwärzesten Tag« der Donaumetropole Budapest wurde er in seiner Villa Neuschloss am Rosenhügel verhaftet. Er kam ins Gefängnis Oberlanzendorf bei Wien und schließlich ins Konzentrationslager Mauthausen. Der Unternehmer, der dem ungarischen Betrieb zur Herstellung von Glühbirnen Tungsram vorstand, hatte durch die Zusammenarbeit mit europäischen und amerikanischen Unternehmen, durch seine Aufgeschlossenheit und seine Fortschrittsbegeisterung früh in Forschung und Entwicklung investiert – und damit Erfolg gehabt. Doch diese Zeiten waren nun vorbei.
Leopold/Lipót Aschner hatte Arbeiterwohnungen, ein Gebäude mit Kantine, Bibliothek und Veranstaltungsräumen, Schwimm- und Sportanlagen errichten lassen, den Spitzensport sowie das soziale, kulturelle Leben im Stadtteil Neu-Pest/Újpest gefördert – doch am »schwärzesten Tag« der Donaumetropole Budapest wurde er in seiner Villa Neuschloss am Rosenhügel verhaftet. Er kam ins Gefängnis Oberlanzendorf bei Wien und schließlich ins Konzentrationslager Mauthausen. Der Unternehmer, der dem ungarischen Betrieb zur Herstellung von Glühbirnen Tungsram vorstand, hatte durch die Zusammenarbeit mit europäischen und amerikanischen Unternehmen, durch seine Aufgeschlossenheit und seine Fortschrittsbegeisterung früh in Forschung und Entwicklung investiert – und damit Erfolg gehabt. Doch diese Zeiten waren nun vorbei.Als Ungarns »schwärzesten Tag« definiert Maren Schoening den 19. März 1944. Es war der Tag, an dem die deutsche Wehrmacht bis in die ungarische Hauptstadt durchmarschierte. Es war der Tag, an dem der Unternehmer Aschner arrestiert wurde und seine Villa in die Hände von Adolf Eichmann geriet. Doch nicht nur seine Lebensgeschichte wird exemplarisch beleuchtet. Die Autorin vollzieht eine Rolle rückwärts in die Geschichte der Ungarn sowie der in Ungarn ansässigen Minderheiten, zu denen unter anderem die Juden und die Ungarndeutschen zählen. Sie geht bis ins 19. Jahrhundert zurück, um zu zeigen, wie nationalistische Politik in die Sackgasse, ja letztlich in die Katastrophe führt.
Im historischen Verlauf kündigt sich die »Schwärze« bereits lange vor dem 19. März 1944 an. Nachdem Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler ernannt hatte, überschlugen sich die Ereignisse und überboten sich an Düsternis. Schoenings Augenmerk gilt den deutsch-ungarischen Verstrickungen, die hier nur angerissen werden können.
Die Einführung der »Nürnberger Gesetze« hatte auch in Ungarn Folgen. Obwohl einige wenige Abgeordnete wie István Bethlen im ungarischen Parlament vor »Nazi-Methoden« im Umgang mit Juden gewarnt hatten, verabschiedete es zwischen 1938 und 1941 drei »Judengesetze«. Die jüdische Bevölkerung wurde Schritt für Schritt entrechtet und enteignet. Nachdem die »Endlösung der Judenfrage« auf der Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942 beschlossen worden war, betonte Ungarns Reichverweser Miklós Horthy im April 1943 anlässlich eines Besuchs bei Hitler, er könne die Juden aus wirtschaftlichen Gründen nicht »ermorden oder sonst wie umbringen« – so der protokollarische Wortlaut. Seinen zurückhaltenden Kurs beschrieb ein Beauftragter des Reichsaußenministers Ribbentrop als »defätistische Einstellung sowie Sabotage am gemeinsamen Kriegsziel« und als »gastfreundliche Einstellung zum Judentum«. Diese konnte aus deutscher Sicht nicht geduldet werden. Kurz vor dem »schwärzesten Tag« notiert Goebbels in sein Tagebuch: »Ungarn hat 700 000 Juden; wir werden dafür sorgen, dass sie uns nicht durch die Lappen gehen.«
Im Frühjahr 1944 waren Wehrmacht, Sicherheitspolizei und der Sicherheitsdienst, die Ordnungspolizei sowie die Waffen-SS in ganz Ungarn stationiert. Der sogenannte Schwabenberg/Svábhegy, ein Naherholungsgebiet der Budapester, wurde mitsamt dem Luxushotel Grand Hotel Budapest sowie vielen weiteren Hotels und Villen beschlagnahmt. Eine neue ungarische Regierung, zusammengesetzt aus militanten Antisemiten, beschloss, dass »das Judentum aus dem Leben der Ungarn vollständig ausgeschaltet« werden sollte.
Die Maßnahmen waren drastisch. Bereits ab dem 21. März 1944 mussten Juden ihre Vermögenswerte anmelden und ihre Geschäfte schließen; alle Juden ab sechs Jahren mussten den gelben Stern tragen; im Amt verbliebenen Beamten, Journalisten, Notaren, Anwälten usw. wurde Berufsverbot erteilt; der Besitz von Telefonen, Radios, Schreibmaschinen, Motorfahrzeugen oder Fahrrädern wurde ihnen verboten, alles musste abgeliefert werden. Selbst die Lebensmittelrationen wurden gekürzt. Es folgte die Anweisung zur Konzentration der jüdischen Bevölkerung in Sammellagern, Judenhäusern und Ghettos. Bis Anfang Juni 1944 wurden über 400 000 Juden mit 147 Zügen nach Auschwitz deportiert.
Am 6. Juli 1944 versuchte Horthy, die Deportationen zu stoppen, doch Hitler drohte ihm mit seiner Beseitigung. Horthy sah sich gezwungen, mit Moskau zu verhandeln. Er unterschrieb am 11. Oktober 1944 ein Abkommen mit den Sowjets, in dem er seine Bereitschaft zum Friedensschluss mit den Alliierten erklärte. In einer Radioansprache am 15. November 1944 kündigte er die Unterstützung des Deutschen Reiches auf. Kurz darauf besetzten deutsche Einheiten den Radiosender. Horthy wurde gezwungen – unter Androhung der Ermordung seines Sohnes, der bereits im KZ Mauthausen inhaftiert war – abzudanken.
Der neue Ministerpräsident Ferenc Szálasi schwor das Land auf die »deutsch-ungarische Waffenbrüderschaft« ein und ließ die antisemitische Pfeilkreuzler-Partei frei walten. Der Terror mit willkürlichen Erschießungen am Donauufer, mit Massakern und Deportationen kannte keine Grenzen. Am 20. Oktober 1944 erreichte die Rote Armee die ostungarische Stadt Debrezin/Debrecen, acht Tage später begann der Kampf um Budapest. Im März 1945 hatte die Rote Armee ganz Ungarn erobert, doch der Frieden blieb aus. Stalins Herrschaft schlug ein neues Kapitel des Schreckens für die Bevölkerung Ungarns auf.
Mit Blick auf die heutige politische Weltlage sei es »geboten, aufmerksam zu sein«, so Maren Schoening. Als Kommunikationsexpertin gelingt es ihr, komplexe Zusammenhänge in klarer, verständlicher Sprache darzustellen. Als Mitinitiatorin und Gründungsmitglied des Deutsch-Ungarischen Jugendwerks ist es ihr ein Anliegen, mit ihrem populärwissenschaftlichen Ansatz vor allem jüngere Menschen zu erreichen. Sie habe beobachtet, dass in Ungarn heute der Holocaust und die Verantwortung des eigenen Landes dafür »eine eher untergeordnete Rolle« einnehmen. Der Relativierung und den Stimmen, die vor einem vermeintlichen »Schuldkult« warnen, wolle sie etwas entgegensetzen: »Gerade jetzt, da die Zeitzeugen immer weniger werden, ist es wichtig in deren Namen die Erinnerung wachzuhalten.«
Schoening, Maren: Der schwärzeste Sommer – Als der Holocaust nach Ungarn kam
TiedVerlag, Berlin 2025
203 Seiten
ISBN 978-3-00-080344-4