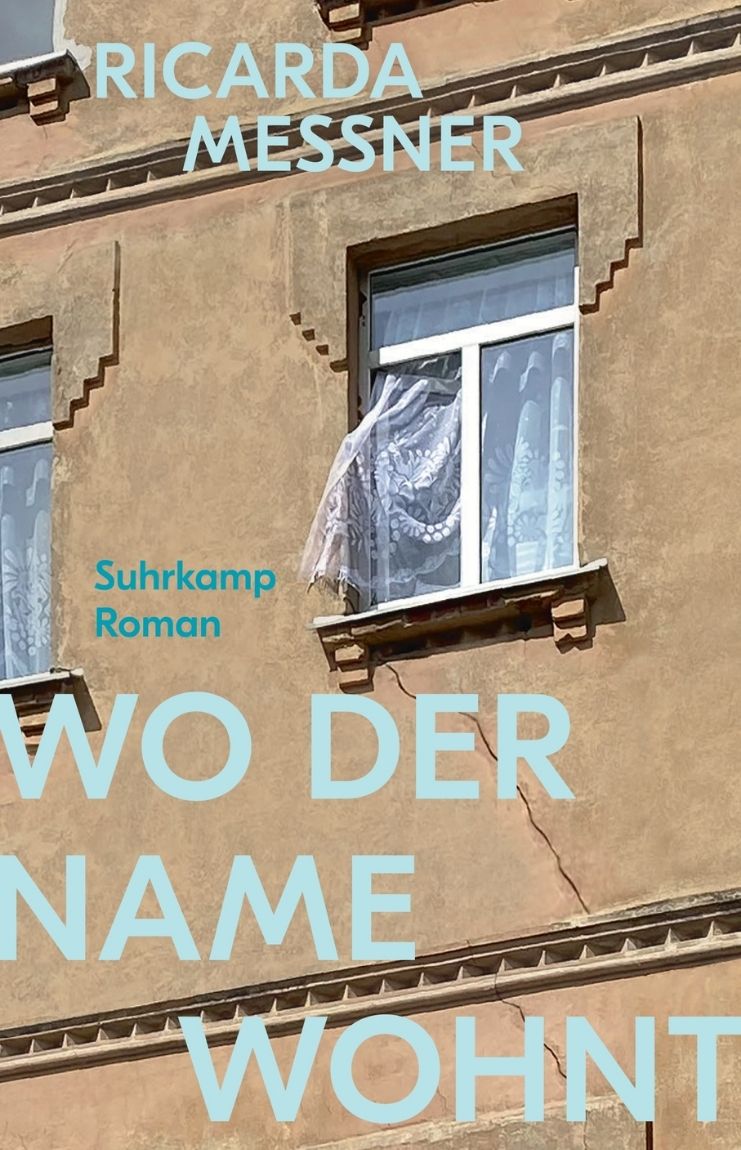 »Hat man eine dünne Haut, lässt sie nicht nur das eigene Innere durch, das lauter schlagende Herz, den knurrenden Magen, das Rauschen im Ohr, sondern durch die dünne Haut tritt auch das Äußere ungefragt ein.« Als eine Frau mit dünner Haut wird die Mutter der Ich-Erzählerin eingeführt, doch das, was für Erstere gilt, trifft auch für Letztere zu. Treffend wäre auch das Epitheton »feinporig«. Denn sensibel und differenziert nähert sich die Urenkelin des Schneiders Salomon Levitanus aus Riga den Herkunftsgeschichten ihrer Familie mütterlicherseits. Neugierde ist zwar im Spiel, doch überwiegt die Diskretion – das Verstehen-Wollen der Familienzusammenhänge wird mit Empathie betrieben. Das Ergebnis der Spurensuche ist eine Erzählung.
»Hat man eine dünne Haut, lässt sie nicht nur das eigene Innere durch, das lauter schlagende Herz, den knurrenden Magen, das Rauschen im Ohr, sondern durch die dünne Haut tritt auch das Äußere ungefragt ein.« Als eine Frau mit dünner Haut wird die Mutter der Ich-Erzählerin eingeführt, doch das, was für Erstere gilt, trifft auch für Letztere zu. Treffend wäre auch das Epitheton »feinporig«. Denn sensibel und differenziert nähert sich die Urenkelin des Schneiders Salomon Levitanus aus Riga den Herkunftsgeschichten ihrer Familie mütterlicherseits. Neugierde ist zwar im Spiel, doch überwiegt die Diskretion – das Verstehen-Wollen der Familienzusammenhänge wird mit Empathie betrieben. Das Ergebnis der Spurensuche ist eine Erzählung.
Mit dem Jahr 1971 beginnt in der Familie Levitanus aus Riga, Hauptstadt der Lettischen Sozialistischen Sowjetrepublik, eine neue Zeitrechnung. Dem Großvater der Ich-Erzählerin, der Jiddisch, Lettisch und Russisch spricht, gelingt mit seiner Familie die Ausreise über Warschau nach Wien. Eine israelische Zeitung habe sogar die Ankunft des bekannten Fußballtrainers mit seiner Ehefrau und der 22-jährigen Tochter angekündigt, heißt es bei der »Jüdischen Agentur für das Land Israel« in Wien. Doch entscheidet der Großvater, dass sein neues Zuhause Deutschland sein soll – schließlich sei er »aus Lettland raus, um frei entscheiden zu können«. Seiner Devise bleibt er treu, selbst wenn ihn in Berlin, seinem Ziel, niemand kennt. Doch hier gab es einst ein Haus, das der Familie gehörte und das während des Zweiten Weltkriegs von den Bomben verschont geblieben ist.
Bis der Tod sie scheidet leben die Großeltern fortan zusammen in Berlin – dann wird der Großvater auf dem jüdischen und die Großmutter einige Jahre später auf dem evangelischen Friedhof beerdigt. Zweimal fasst die Enkelin95 Jahre Leben auf wenigen Seiten Papier zusammen – das erste Mal für den Rabbi und das zweite Mal für den evangelischen Pfarrer. Doch bis zum Tod der beiden wird die Ich-Erzählerin, die lediglich eine Hausnummer von ihnen entfernt wohnt, noch viel Kascha mit Preiselbeeren mit ihren Großeltern verspeist, mit ihrem Großvater einige Tischtennisrunden auf dem Wohnzimmertisch absolviert und von ihm einen legendären Münz-Zaubertrick gelernt haben.
Sie weiß nicht, »wie ich mich vor den Gräbern geliebter Menschen verhalten, in welcher Haltung ich den Steinen begegnen soll«. Doch sie erinnert an deren Geschichten und lässt die Menschen, die darin vorkommen, auferstehen: »Oft schaue ich mir keine Fotos von Großmutter und Großvater an, sondern hole sie in Gedanken zurück«.
Überall nimmt die Ich-Erzählerin Fährten auf, um die 18 Jahre zwischen ihrer Geburt und der Ankunft ihrer Familie mütterlicherseits in Deutschland zu verstehen, denn sie will das »Früher«, das ihre Großeltern und mit ihrer Mutter verbindet, nachvollziehen. Sehr schnell lernt sie, dass dieses »Früher« eine Zeit ist, in der sich der Lebenshorizont der Familie verdüsterte. Sie bringt in Erfahrung, dass ihre Verwandten dem Rigaer Blutsonntag am 30. November 1941 nur deshalb nicht zum Opfer fielen, weil sie bereits vorher durch lettische Faschisten ermordet worden waren – der Urgoßvater Salomon war bereits im Rigaer Zentralgefängnis zu Tode geprügelt, die Urgoßmutter Rosa mit ihrer Tochter Tusja im Rigaer Ghetto erschossen und der Sohn Alexander bei Aufräumarbeiten, zu denen Juden täglich von der Straße weg oder aus ihren Wohnungen abgeholt wurden, erschlagen worden.
Die Mutter der Ich-Erzählerin tut die »unbestimmte Suche« der Tochter als »Vergangenheitsinventur« ab, sie selbst hat mit dieser Vergangenheit abgeschlossen. Dennoch steht sie der Tochter bei einer Reise nach Riga als Übersetzerin zur Seite: »Es ist unser stilles Geheimnis, dass die fehlenden Sprachen uns verbinden, dass ich sie heute wie gestern und morgen immer wieder fragen kann, fragen muss, was bedeutet das, was steht da, was hat die Person gesagt, was hast du geantwortet?« Die Mutter wird der Tochter keine Antwort schuldig bleiben, die Ich-Erzählerin zufrieden sein, selbst wenn ihr bewusst ist, »dass die Hälfte der Geschichten, die sie übersetzt, verändert oder sogar erfunden ist«. Doch sind sie »deshalb nicht weniger wahr«. Der Wahrheitsbegriff Ricarda Messners ist ein lebendiger, ihr Roman führt ihn uns vor.
Ricarda Messner: Wo der Name wohnt.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2025, 170 S., ISBN 978-3-518-43232-7