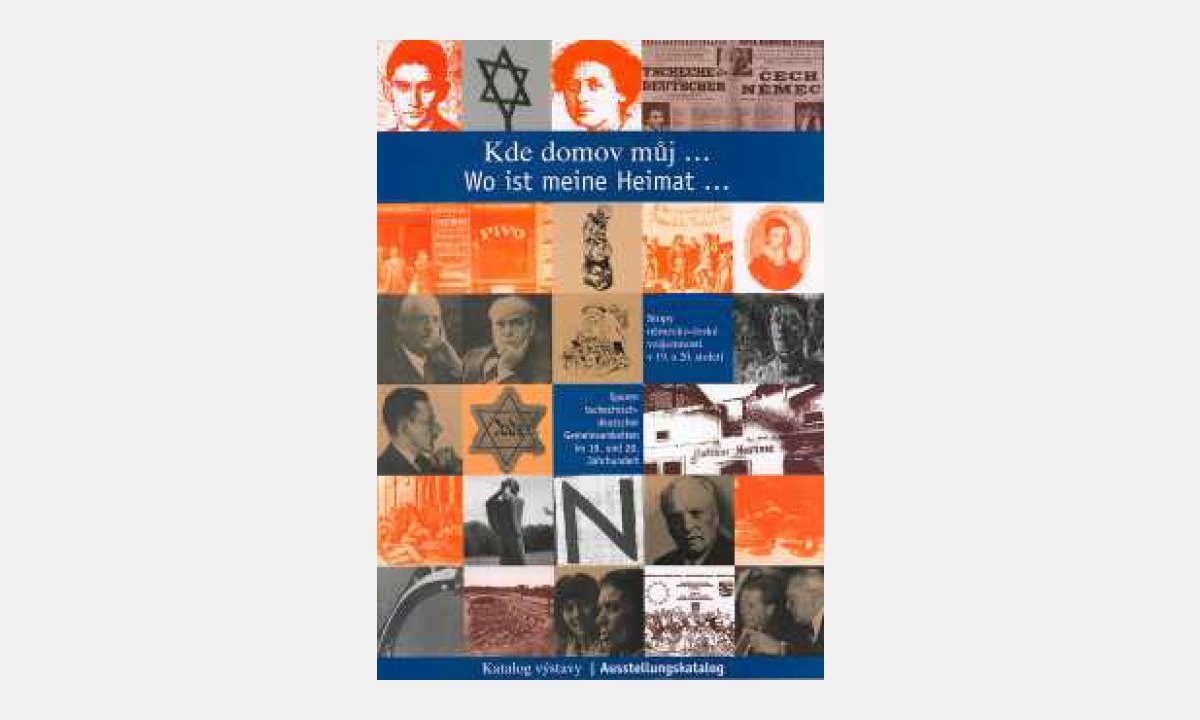Eine Podiumsdiskussion mit Detlef Brandes, Boris Lazar und Ludmila Stuchlíková am 15.05.2003 im Alten Rathaus Potsdam
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der deutsch-tschechischen Beziehungen sollten sie verkörpern: der Düsseldorfer Historiker Prof. Dr. Detlef Brandes, der Botschafter der Tschechischen Republik in der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Boris Lazar, und Ludmila Stuchlíková, Leiterin des Pilsener Büros von Tandem, Koordinierungszentrum für deutsch-tschechischen Jugendaustausch. Wie in der öffentlichen Diskussion seit einigen Jahren üblich, wurde die gemeinsame europäischen Zukunft mit der Geschichte, genauer gesagt mit den unheilvollen Jahren 1938 bis 1945, verknüpft. Erwartungsgemäß stand schon durch die Formulierung des Themas die Vergangenheit im Vordergrund des Gesprächs, zu dem die Potsdamer Mostar Friedensinitiative im Rahmenprogramm zur zweisprachigen Ausstellung Wo ist meine Heimat? Spuren tschechisch-deutscher Gemeinsamkeiten im 19. und 20. Jahrhundert eingeladen hatte.
Detlef Brandes, Mitglied der seit 1990 existierenden Deutsch-Tschechischen Historikerkommission, gelang es, dem Publikum die historische Komplexität des Themas zu vermitteln – wenn es auch Zuhörern mit geringeren Vorkenntnissen auf diesem Gebiet bei seinen umfassenden historischen Ausführungen etwas schwindlig werden konnte. Brandes datierte den Beginn des nationalen Konfliktes auf das Jahr 1848, als mit der bürgerlichen Revolution die »nationale Wiedergeburt« der Tschechen im Habsburger Reich begann. Als den schärfsten Einschnitt in der Geschichte der Beziehung zwischen den beiden Völkern in Böhmen und Mähren bezeichnete er das Münchner Abkommen vom 29. September 1938, das die Abtretung der sudetendeutschen Gebiete an das Deutsche Reich vorsah. Es folgten der Einmarsch der Deutschen in die »Rest-Tschechei«, die Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren, die Vernichtung der tschechoslowakischen Juden, Ausbeutung des Landes, Terror gegen Andersdenkende und nach Kriegsende die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der wiedererstandenen tschechoslowakischen Republik.
Sowohl der erste Staatspräsident der Tschechoslowakischen Republik, Tomáš Garrigue Masaryk, selbst Sohn einer deutschen Mutter, als auch sein Nachfolger Edvard Beneš hätten, so Brandes, bis zur Radikalisierung der Sudetendeutschen Partei ab 1934 eine deutschfreundliche Politik betrieben. Beneš war unter dem Druck des nationalsozialistischen Deutschland zu immer weiter gehenden Zugeständnissen bereit, ja erwog sogar die Abtretung der mehr als zur Hälfte von Deutschen bewohnten Gebiete in Verbindung mit einer Umsiedlungsaktion. Die Sudetendeutsche Partei hatte Hitler jedoch versprochen, keines dieser Angebote anzunehmen, um bewusst eine Krise zu provozieren, die den Nationalsozialisten einen Grund zum Einmarsch geben würde.
Hitler verfolgte eine zynische »Lösung der tschechischen Frage«: Der »gutrassige, gutgesinnte« Teil der Tschechen sollte germanisiert, der »schlechtrassige« und »gutrassige, schlechtgesinnte« Teil nach Sibirien in »russische Konzentrationslager« gebracht werden. Da das Protektorat jedoch kriegswirtschaftlich wichtig war, verschob man diese Pläne. Das nach dem Krieg zu erreichende Endziel war die »Eindeichung« und »Germanisierung« der Tschechen.
Nach dem Sieg der Alliierten wurden die von grausamen Gewaltakten begleiteten Zwangsaussiedlungen der Deutschen durch zwei Regierungsbeschlüsse des wieder eingesetzten Staatspräsidenten Beneš legitimiert. Sie verkündeten den Entzug deren Staatsbürgerschaft und deren Eigentums. Die Entrechtungen und Vertreibungen wurden systematisch betrieben, auch nachdem im Potsdamer Abkommen der Alliierten die »ordnungsgemäße und humane Weise« des »Transfers« der Deutschen beschlossen worden war.
Transfer, Vertreibung, Ausweisung, Zwangsaussiedlung oder Abschub – schon die Bezeichnung des Vorgangs ist umstritten, da sie immer auch eine Wertung in sich trägt. Die Deutsch-Tschechische Historikerkommission versucht die Terminologie an geschichtlichen Phasen der Aussiedlung festzumachen. Brandes sprach sich jedoch dafür aus, den Betroffenen den Begriff Vertreibung nicht »wegzunehmen«.
Von einer Verweigerung der Aufarbeitung des Themas auf tschechischer Seite kann heute nicht mehr die Rede sein. Brandes wies darauf hin, das die wichtigsten Arbeiten über die Durchführung der Vertreibung von tschechischen Historikern stammten und tschechische Schulbücher bei der Darstellung dieser Ereignisse ausgewogen und auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Forschung seien.
Befragt nach der Aufhebung der Beneš-Dekrete, die Premierminister Vladimír Špidla bei seiner kürzlich gehaltenen Rede vor Studenten in Frankfurt a/M verneint hat, erinnerte Boris Lazar daran, dass das tschechische Parlament die Beneš-Dekrete im Frühjahr 2002 parteiübergreifend als durchgeführt und »konsumiert« bezeichnet und ihnen keine Bedeutung als Rechtsgrundlage für die Zukunft eingeräumt habe. Sowohl das englische, das schwedische als auch das deutsche Gutachten der Europäischen Union hätte ergeben, dass die Aufhebung der Dekrete keine Bedingung für die EU-Mitgliedschaft Tschechiens ist. Allerdings habe der schwedische Völkerrechtler Klärungsbedarf hinsichtlich des Straffreiheitgesetzes festgestellt, durch das im Rahmen der Vertreibung geschehene Verbrechen wie Folterungen und Vergewaltigung seinerzeit nicht geahndet wurden.
Lazar wies auch darauf hin, dass aus einer Aufhebung der Beneš-Dekrete die Entschädigung der Sudetendeutschen resultieren würde. Bereits zu Beginn der neunziger Jahre habe die tschechische der deutschen Regierung die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft für die ehemaligen deutschen Landsleute angeboten. Dies nahm die Regierung Kohl damals nicht an, da sie wohl keinen Präzedenzfall gegenüber den in der Bundesrepublik lebenden Ausländern schaffen wollte.
Heute begreifen die Tschechen Geschichte und Kultur der Deutschen aus Böhmen und Mähren als Teil ihrer Landeshistorie. Dagegen würden es die meisten deutschen Medien nach Lazars Beobachtungen oft kaum beachten, wenn Gedenktage sudetendeutscher Persönlichkeiten anstünden, während sie die tschechische Botschaft mit Veranstaltungen ehrt. Die so genannten Beneš-Dekrete seien dagegen für die Deutschen mittlerweile ein »Bestseller« geworden und Teil der zunehmenden Entdeckung ihrer Opferrolle im Zweiten Weltkrieg. Wesentlicher als seine Äußerung zu den Dekreten, mit der er auf eine Frage aus dem Publikum reagierte, sei an der Frankfurter Rede Špidlas doch ihr eindeutiges paneuropäisches Bekenntnis gewesen, von den zuhörenden Studenten deutlich honoriert. Ihren spontanen Applaus, der Špidlas Absage an eine Aufhebung der Dekrete gefolgt sei, könne man wohl als ein Zeichen ihres Überdrusses an dem durch provokante Äußerungen tschechischer, österreichischer und deutscher Politiker und Funktionäre wieder hochgespielten Thema interpretieren.
In Tschechien richte sich der Blick zur Zeit eher in die Zukunft. Die Menschen sind mit dem bevorstehenden EU-Beitritt befasst. Konkurrenzängste gebe es hier nur unter überregional, aber nicht international orientierten Unternehmen. Ansonsten sei die Tschechische Republik wirtschaftlich bereits in Europa integriert. Kein anderes Beitrittsland habe eine vergleichbar hohe Exportquote nach Deutschland.
Ludmila Stuchlíková macht bei ihrer Arbeit mit Jugendlichen ebenfalls positive Erfahrungen. Umfragen unter jungen Tschechen hätten deren sehr positive Einstellung zur Europäischen Union gezeigt, besonders hinsichtlich neuer Arbeitsmöglichkeiten und des europäischen Rechts. Es gebe Jugendinitiativen, die sich für die Wiederentdeckung und den Erhalt deutscher Spuren in ihren Heimatregionen einsetzten, etwa die Brünner »Jugend für interkulturelle Verständigung«/»Mladež pro interkulturní porozumĕní«. Tandem veranstalte Begegnungen und Aktionen mit Jugendorganisationen sudetendeutscher Vereinigungen, so mit der »Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde« oder der »Sudetendeutschen Jugend« , hier gebe es keinerlei Berührungsängste.
Detlef Brandes wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es Hunderte von deutsch-tschechischen Projekten und Initiativen gebe – vom Fußballverein bis zu gemeinsamen Institutionen auf dem Felde der Politik, Wissenschaft und Wirtschaft – wesentlich mehr als zwischen Deutschen und Polen, deren Verhältnis von den Medien immer wesentlich positiver als das deutsch-tschechische dargestellt wird.
Im Publikum saßen in der DDR aufgewachsene Vertriebene, die sich mit der Weigerung der tschechischen Politiker, die fraglichen Beneš-Dekrete abzuschaffen, nicht zufrieden geben wollten. Ihre Väter waren Sozialdemokraten oder Kommunisten, die als Antifaschisten in der Tschechoslowakei hätten bleiben können. Angesichts der Zwangsaussiedlung ihrer Landsleute machte damals nur ein Bruchteil der Betroffenen von diesem Angebot Gebrauch. Die meisten gingen in die westlichen Besatzungszonen und etwa 30 000 in die SBZ.
Gefragt nach seiner Meinung zum vom Bund der Vertriebenen geplanten »Zentrum gegen Vertreibungen« plädierte Detlef Brandes dafür, diesem Thema besser eigene Abteilungen in den Historischen Museen Deutschlands, Tschechiens oder Polens zu widmen. Hinter der Idee, ein Zentrum als Mahnmal zu errichten, sei doch der Anspruch sichtbar, sich an das Holocaust-Mahnmal in Berlin anzulehnen, wodurch die Gefahr der Gleichsetzung der Vertreibungen mit der Vernichtung der Juden bestünde. Mit Bezug auf die vom SPD-Bundestagsabgeordneten Markus Meckel vertretene Idee, das Zentrum lieber in Breslau als in Berlin zu errichten, sah Lazar in Tschechien keinen Bedarf für die Beteiligung an einem solchen Projekt. Seiner Meinung nach sollten Denkmäler kein Vorwurf sein. Unaufdringliche Mahnmale hätten oft eine um so eindringlichere Wirkung, wie die schlichte Tafel in einem Wald in Nordböhmen, die an den an dieser Stelle vernichteten sudetendeutschen Ort erinnert. Frau Stuchlíková sprach sich dafür aus, lieber finanzielle Mittel zur Einrichtung von deutsch-tschechischen Begegnungshäusern für Alt und Jung zu verwenden. Dies wäre auf dem Weg zum gegenseitigen Verstehen wichtiger als eine Musealisierung, die immer auch die Gefahr einer Pauschalierung in sich birgt.
Wenn das Podiumsgespräch auch von manchem Besucher als fruchtlos empfunden wurde, machte es doch wieder einmal die Vielschichtigkeit des Themas bewusst. Geschichte und gegenseitig zugefügte Wunden kann man nicht wirklich »ausdiskutieren«. Voraussetzung für eine gemeinsame Zukunft ist Sensibilität, genaues Zuhören und Respekt für die Auffassung der anderen Seite, nicht das Überzeugen um jeden Preis. Hier hat die Deutsch-Tschechische Erklärung von 1997 mit ihrem gegenseitigen Eingeständnis von Schuld und der Versicherung, das Verhältnis der beiden Länder damit künftig nicht mehr belasten zu wollen, bereits Zukunftsweisendes geleistet.
Literaturtipps
- Detlef Brandes/Edita Ivančková/Jiří Pešek (Hrsg.), Erzwungene Trennung. Vertreibungen und Aussiedlungen in und aus der Tschechoslowakei 1938–1947 im Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien. Essen: Klartext Verlag 1999
- Detlef Brandes, Der Weg zur Vertreibung. 1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum »Transfer« der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen. München: Oldenbourg Verlag 2003
- Jaroslav Kučera, Edvard Beneš und die tschechoslowakische Außenpolitik 1918–1948. Frankfurt: Peter Lang Verlag 2002
- Jaroslav Kučera, Der Hai wird nie wieder so stark sein. Tschechoslowakische Deutschlandpolitik 1945–1948. Dresden: Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung 2001
- Friedrich Prinz (Hrsg.), Böhmen und Mähren, erschienen in der Reihe Deutsche Geschichte im Osten Europas. Berlin: Siedler Verlag 1993
- Deutsch-Tschechische Erklärung von 1997
PDF-Datei, ca. 11 KB
- Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds
Informationen in deutscher und tschechischer Sprache