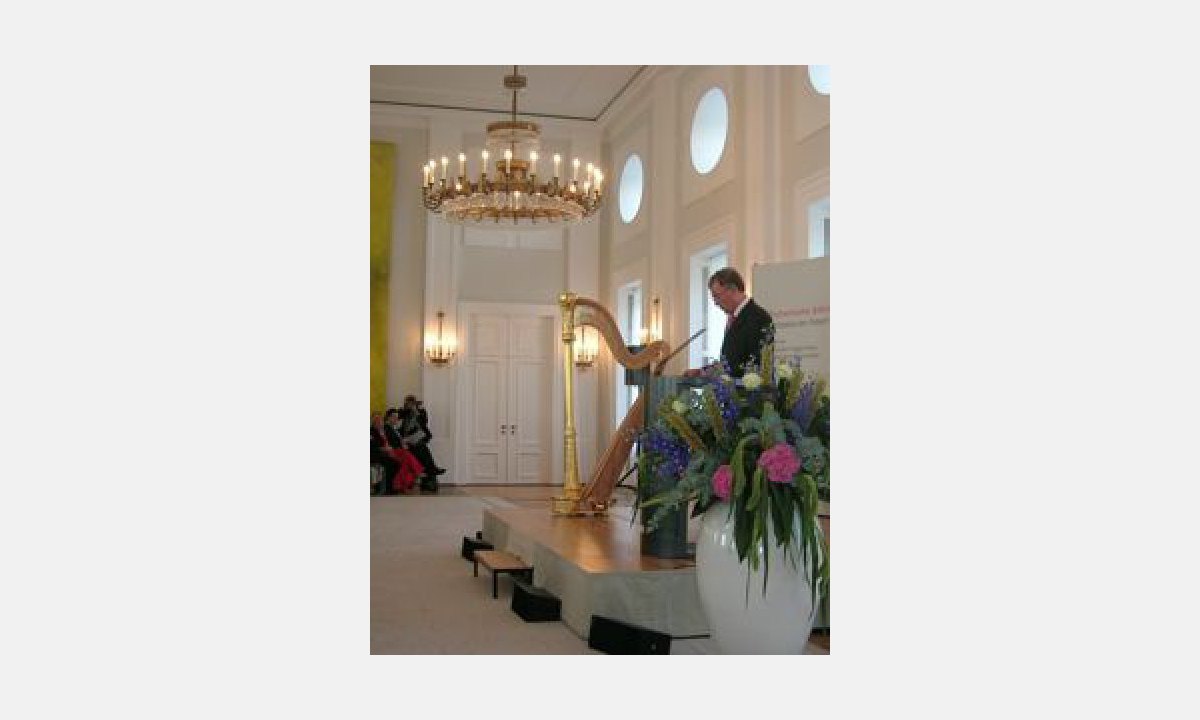Bundespräsident Horst Köhler lud als Schirmherr des Projekts alle Beteiligten in das Schloss Bellevue ein. Der zweite Teil des Festaktes fand am Abend in der Tschechischen Botschaft statt.
Mit dem Titel Die Hunde von Konstantinopel, einer Sammlung von Reisebildern des tschechischen Schriftstellers Jan Neruda, ist im Sommer 2007 der letzte von 33 Bänden der Tschechischen Bibliothek erschienen. In die umfangreichste tschechische Literatursammlung außerhalb Tschechiens fanden Texte von 213 Autoren Aufnahme, viele davon erschienen erstmals auf Deutsch. So entstand ein Überblick über das Werk der wichtigsten tschechischen Schriftsteller, Publizisten und Philosophen seit Johann Amos Comenius (1592–1670).
Der Abschluss dieser verlegerischen Großtat war Anlass für eine Feierstunde am 24. August 2007, zu der Bundespräsident Horst Köhler als Schirmherr des Projekts alle Beteiligten in das Schloss Bellevue bat. Der Einladung folgte ein Großteil der 66 namhaften Übersetzer und Bohemisten, die an der Herausgabe mitgewirkt hatten. Auch Vertreter der DVA, unter deren Dach die Reihe erschien, und bekannte Schriftsteller wie Pavel Kohout, Jiří Gruša oder der ehemalige tschechische Botschafter František Černý fanden sich unter den Gästen. Mitinitiatorin der Veranstaltung war die Robert Bosch Stiftung, die mit einer Fördersumme von rund einer Million Euro die finanzielle Basis für die Edition bereitstellte.
»Deutschland ist von Freunden umgeben«, mit dieser Feststellung eröffnete Horst Köhler den Festakt. Weil Sprachkenntnisse eine wichtige Voraussetzung für das Knüpfen und die Pflege freundschaftlicher Kontakte sind, sei die Rolle guter Literaturübersetzungen nicht zu unterschätzen. Köhler erinnerte an die gemeinsamen literarischen Traditionen von Deutschen und Tschechen, die ihr Zentrum in der Stadt Prag fanden. Bei der Gestaltung der gemeinsamen Heimat Europa gälte es, an diesen Aspekt der Geschichte anzuknüpfen.
Anschließend übermittelte der Botschafter der Tschechischen Republik, Rudolf Jindrák, das Grußwort des tschechischen Präsidenten Václav Klaus. Neben der kulturellen und politischen Relevanz des Editionsprojekts führte er auch »harte Fakten« ins Feld: Verkaufserfolge auf dem deutschen Buchmarkt und die mehrmalige Dotierung mit dem Kritikerpreis »Buch des Monats«. Jindrák brachte den Wunsch seines Landesherren zum Ausdruck, die deutschen Leserinnen und Leser mögen die Hand ergreifen, die ihnen mit dieser Edition gereicht wurde.
Für die Robert Bosch Stiftung sei die Tschechische Bibliothek nicht nur ein wichtiges Element der Völkerverständigung, ergänzte Ingrid Hamm, die Geschäftsführerin der Stiftung. Sie sei auch ein Kompliment an den Reichtum, die Bedeutung und die Schönheit der tschechischen Kultur. Ingrid Hamm lüftete in ihrer Ansprache das Geheimnis des unkonventionellen Reihenumfangs: »Dreihundertdreiunddreißig Lerchen fliegen über dreihundertdreiunddreißig Dächer«, heißt es in einem tschechischen Zungenbrecher. 333 Bände hätte die Stiftung wohl gern gefördert, sie hätten aber kaum in einem überschaubaren Zeitraum erscheinen können. So fliegen nun dreiunddreißig tschechische Lerchen über deutsche Dächer.
Eine sehr persönliche Rückschau auf zehn Jahre verlegerische Arbeit an der Tschechischen Bibliothek hielt im Anschluss Eckhard Thiele, Bohemist und Redakteur der Gesamtedition; Bundespräsident Horst Köhler hatte ihn vor der Veranstaltung mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Thiele betonte, dass es bei der Auswahl der aufgenommenen Werke nicht um die Zementierung eines Kanons der tschechischen Literatur ging. Er verglich die Tschechische Bibliothek mit einer Landschaft, in der es neben den »Leuchttürmen« auch Querverbindungen und Seitenwege zu entdecken gäbe. So sind Ivan Klíma und Pavel Kohout hier ausnahmsweise als Dramatiker vertreten, Božena Němcová ist als Verfasserin eindrucksvoller Briefe zu bewundern. Die Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss der Buchreihe war nach Thieles Einschätzung, dass die Herausgeber jederzeit auf ein »großartiges Netzwerk« von Mitstreitern zurückgreifen konnten. In seinem Schlusswort schwang jene Mischung von Optimismus und leichter Melancholie mit, die oft am Ende einer intensiven Arbeitsphase steht: »Die Sonne scheint uns nun nicht mehr, fortan muss eigenes Feuer leuchten.«
Als letzter Redner des Vormittags ergriff Mitherausgeber Jiří Gruša das Wort. »Die deutsche Sprache ist die Sprache meiner Freiheit«, begann der ehemalige Dissident und heutige Präsident des Internationalen PEN-Klubs seine Lesung. Im Wiener Exil habe er lange unter dem Verlust seiner Muttersprache gelitten, bis er begann, auf Deutsch Gedichte zu schreiben. Fünf von ihnen brachte er anschließend zu Gehör.
Stimmungsvoll umrahmt wurde die Veranstaltung vom Spiel der tschechischen Harfenistin Jana Boušková, die Werke von Jan Ladislav Dusík und Félix Godefroid darbot.
Der zweite Teil des Festaktes fand am Abend in der Tschechischen Botschaft statt. Gastgeber Rudolf Jindrák bezeichnete in seiner Begrüßungsansprache die Tschechische Bibliothek als »glückliches Kind mit vielen Vätern«: Jeder der fünf Herausgeber – Hans Dieter Zimmermann, Peter Demetz, Jiří Gruša, Eckhard Thiele und Peter Kosta – hätte seine ganz persönlichen Erfahrungen geglückter deutsch-tschechischer Beziehungen in den Schaffensprozess eingebracht. Vizeminister František Mikeš hob die Bedeutung der Muttersprache für die Bewahrung von Identität und für die Weitergabe von Werten hervor. Daran anknüpfend wies Joachim Rogall von der Robert-Bosch-Stiftung auf die lange Tradition der Sprach- und Literaturpflege im Programm seiner Organisation hin. Abschließend nahm Hans Dieter Zimmermann als geschäftsführender Herausgeber der Tschechischen Bibliothek seine Zuhörer mit auf eine Reise zu den Anfängen des Projekts. Er erinnerte an den historischen Augenblick im Prager Café Louvre, als Peter Demetz auf einem Bierdeckel die ersten Konzepte notierte. Rückblickend bezeichnete Zimmermann die Arbeit an der Tschechischen Bibliothek liebevoll als eine »Zeit der Begegnung mit Menschen und Büchern«. Die Literatur eines kleinen Landes wie Tschechien ist nach seiner Auffassung nicht zwangsläufig provinziell, weil die Schriftsteller und Intellektuellen die Literatur jenseits der Grenzen stets wahrgenommen haben. So verstanden, sei Provinzialismus eher in Deutschland anzutreffen, denn dort herrsche weitgehende Unkenntnis über die Autoren des Nachbarlandes. Ein Grundstein für die Überwindung dieses Zustandes ist mit dem Erscheinen der Tschechische Bibliothek gelegt.
Abgerundet wurde die Veranstaltung von einer szenischen Lesung ausgewählter Texte der Tschechischen Bibliothek. Margit Bendokat las einen Brief von Božena Němcová an ihren Mann aus dem Band Mich zwingt nichts als die Liebe – ein Text, der nicht ohne Drastik die eigenwillige Sicht der Autorin auf die Geschlechterverhältnisse ihrer Zeit zutage treten lässt. Den krönenden Abschluss des Programms bildete ein Auszug aus dem Band Das Baßsaxophon von Josef Škvorecký, der von der Rolle des Jazz für die Unangepassten in der Nazizeit und unter dem kommunistischen Regime erzählt. Den Schauspielerinnen Lavinia Wilson und Margit Bendokat standen dabei Johannes Bauer an der Posaune und Willi Kellers am Schlagzeug temperamentvoll zur Seite.