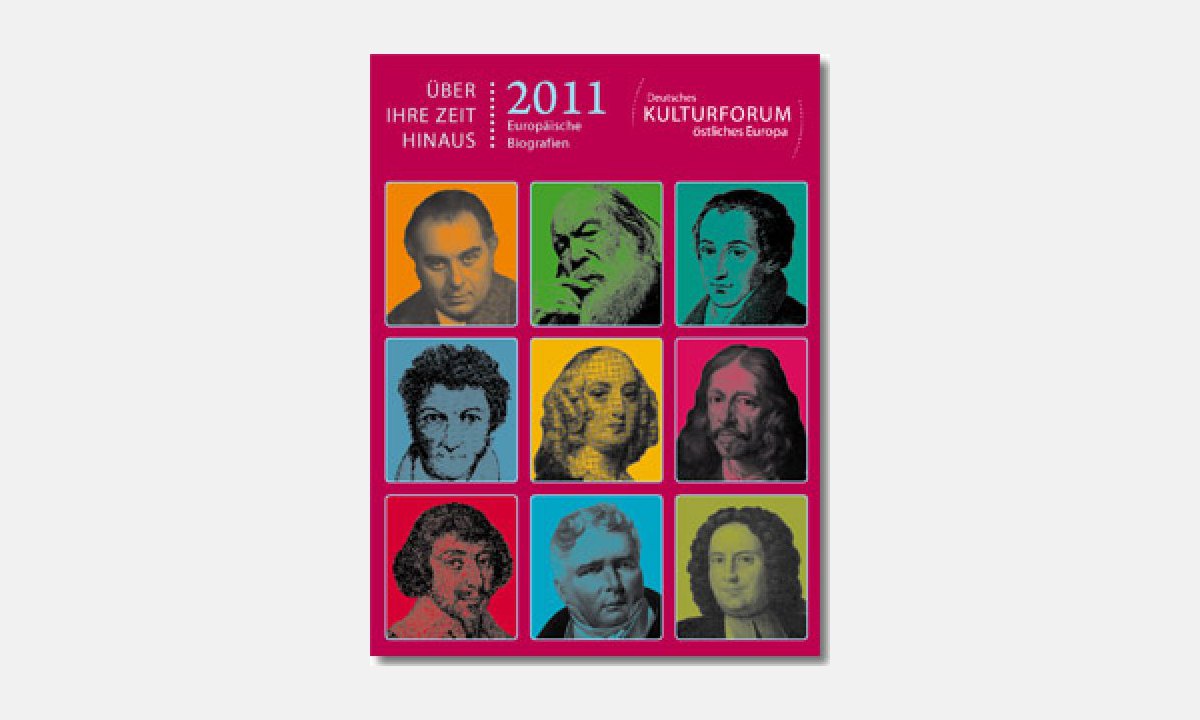Persönlichkeiten, die ihre Zeit prägten, stehen im Mittelpunkt unseres Jahresschwerpunkts 2011. Es sind Menschen, deren Schaffen nicht allein örtlich, sondern auch zeitlich ausstrahlte – deutlich über ihr Leben hinaus, oft bis heute. Dem Anliegen des Deutschen Kulturforums östliches Europa entsprechend geht es dabei um Menschen, die aus dem östlichen Europa kamen oder die dort wirkten – nicht selten überspannen ihre Biografien den gesamten Kontinent. Die deutsche Sprache ist zwar das zentrale und verbindende Medium aller in dieser Reihe vorgestellten Persönlichkeiten, doch sind alle in kaum geringerem Maße auch mit anderen Sprachen und Kulturen vertraut. Sie stehen beispielhaft für den stets praktizierten kulturellen Austausch im östlichen Europa.
Dabei geht es um bekannte Persönlichkeiten wie die Dichter und Schriftsteller Martin Opitz, August von Kotzebue, E. T. A. Hoffmann oder Fanny Lewald, aber auch um Neuentdeckungen. Der Literat Johannes Urzidil etwa, der Astrologe Johannes Hevelius, der Theologe Daniel Ernst Jablonski oder der Friedensapostel Gusto Gräser sollen dem Publikum neue, überraschende Einblicke in die Vielfätigkeit des östlichen Europa und der Arbeit des Kulturforums geben.
Das Kulturforum gibt in seiner potsdamer bibliothek östliches europa Publikationen zu seinem Arbeitsgebiet heraus. Einige der Veranstaltungen des Jahresschwerpunkts beziehen sich auf Neuerscheinungen – gerne laden wir Sie zur vertiefenden Lektüre ein.
Zu den Veranstaltungen, die sowohl hier auf der Website, als auch in einem Programmheft zum Ausdrucken (s. vorhandene Materialien) vorgestellt werden, laden wir sie ebenso herzlich ein wie zu den übrigen Angeboten unseres Jahresprogramms 2011.
VERANSTALTUNGEN
In Böhmen und Mähren geboren
Zwölf ausgewählte Lebensbilder
Ausstellung | Angebot für Schüler
Gusto Gräser
Ein Urvater der Alternativbewegung – ein grüner Prophet aus Siebenbürgen
Thementag
Hermann von Salza
Kreuzritter und Diplomat zwischen Kaiser und Papst
Podiumsdiskussion
Johannes Hevelius
Der Himmel über Danzig – Nachtleben und Nachleben eines Astronomen
Thementag
E. T . A . Hoffmann
DurchFlug
Buchpräsentation
Daniel Ernst Jablonski
Brückenschläge im Europa der Frühaufklärung
Ausstellung
August von Kotzebue
Wie unterhaltend darf ein Schriftsteller sein?
Lesung
Fanny Lewald
Eine emanzipierte Schriftstellerin aus Königsberg
Lesung
Martin Opitz
Wieder entdeckt
Lesung und Gespräch
Anton von Radziwill
Politiker und Musiker, Pole und Preuße
Konzert
Anton Ferdinand Titz und Anton Eberl
Quartette für den Zaren Alexander
Konzert
Johannes Urzidil
Hinternational
Buchpräsentation
VERANSTALTUNGSBESCHREIBUNGEN
In Böhmen und Mähren geboren
Zwölf ausgewählte Lebensbilder
Ausstellung | Angebot für Schüler
Die zwölf Persönlichkeiten, deren Biografien hier präsentiert werden, wurden alle im 19. und 20. Jahrhundert in Böhmen, Mahren oder Mährisch-Schlesien, also auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik geboren. Es sind Angehörige des deutschen Sprach- und Kulturkreises, deren Namen oft weltbekannt, deren Herkunft aber heute vielfach in Vergessenheit geraten ist.
Adalbert Stifters Werke, in denen Geschichte und Schönheit des Böhmerwalds eine zentrale Rolle spielen, gehören zur Weltliteratur. Otfried Preußlers beliebte Kinder- und Jugendbucher waren ohne die Sagenwelt des nordböhmischen Isergebirges undenkbar. Weite Teile der in Brünn erzielten Forschungsergebnisse Gregor Mendels sind bis heute für die Genetik unverzichtbar. Sigmund Freuds Kindheitserlebnisse in seinem mährischen Geburtsort Freiberg/Přibor sind in seine Psychoanalyse mit eingeflossen.
Ferdinand Porsche, der bei Reichenberg/ Liberec seine Kindheit verbrachte, hat mit dem berühmten Käfer ein Symbol des Wirtschaftsaufschwungs in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 geschaffen. Oskar Schindler, in Zwittau/ Svitavy geboren und durch Steven Spielbergs Film schindlers liste bekannt, verhalf zum Ende des Zweiten Weltkriegs vielen Juden durch Beschäftigung in seiner Fabrik in Brünnlitz/Brněnec zur Rettung vor dem Tod im Konzentrationslager.
Die Ausstellung zeigt biografische Texte und Fotografien, in denen die Beziehung zwischen Person und Geburtsregion aufgezeigt und überraschende Zusammenhange deutlich gemacht werden.
Das Kulturforum vermittelt Schulen aus Berlin und Brandenburg die Möglichkeit, Vortrage und Workshops zur Ausstellung in den Unterricht einzubauen.
Termine
13. Januar bis 22. April 2011 • Berlin, Tschechisches Zentrum
4. bis 23. Oktober 2011 • Amberg, Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium und Realschule
Gusto Gräser
Ein Urvater der Alternativbewegung – ein grüner Prophet aus Siebenbürgen
Thementag
Der schon früh durch herausragendes künstlerisches Talent auffallende Gustav Arthur Gräser, genannt Gusto, 1879 im kunstsinnigen Kronstadt in Siebenbürgen geboren, schloss sich noch als Jugendlicher den gerade aufkommenden Alternativbewegungen an. Er entfloh der heimatlichen Enge, wurde bald einer der Mitbegründer der Landkommune Monte Verità bei Ascona im Tessin, erlangte Vorbildcharakter als Kriegsdienstverweigerer während des Ersten Weltkriegs im Habsburger Reich und kam mit vielen bedeutenden Künstlern und Geistesschaffenden in Kontakt (Diefenbach, Arp, Hesse, Hauptmann, Th. Mann u.a.).
In den Jahren um 1930 hielt er, in Anspielung auf seine Herkunftsregion oft unter dem Namen Arthur Siebenbürger, »Öffentliche Gespräche« am Alexanderplatz und Vorträge in Berliner Schulen. In der NS-Zeit wiederholt verfolgt und mit Schreibverbot belegt, zog er sich nach München zurück, wo er 1958 vereinsamt starb.
Seine Dichtungen und Kunstblätter, mit denen er sich über Wasser gehalten hatte, haben sich teilweise erhalten. Gräser wurde ab den 60er und 70er Jahren von den Alternativbewegungen wiederentdeckt, es entstanden Studien und jüngst drei Dokumentarfilme über sein Wirken. Das Gusto-Gräser-Archiv in Freudenstein, das bei dieser Veranstaltung mitwirkt, dokumentiert Gräsers Wirken. Mit einem Vortrag, einer Podiumsdiskussion, Filmausschnitten und einer kleinen Ausstellung soll Gusto Gräser für ein Berliner Publikum neu entdeckt werden.
Termin
01. Oktober 2011 • Berlin, Katholische Akademie
Hermann von Salza
Kreuzritter und Diplomat zwischen Kaiser und Papst
Podiumsdiskusion
Der Deutsche Orden entstand Ende des 12. Jahrhunderts im Zusammenhang mit den Kreuzzügen im Heiligen Land. Nachdem er sich 1198 als dritter Kreuzritterorden etabliert hatte, fand er im Jahr 1211 in der Berufung durch den ungarischen König in den Osten Siebenbürgens seine erste größere Aufgabe. Doch der umtriebige Hochmeister Hermann von Salza (1209/10–1239) sollte dem Orden noch zahlreiche andere Wirkungsstätten erschließen. Neben der zeitweiligen Rückkehr ins Heilige Land bot dem Orden vor allem die Verleihung eines Missionsgebiets im Nordosten Europas, im späteren Preußen, eine langfristige Aufgabe. Hermann von Salza errang seine und somit des Ordens Erfolge vor allem durch sein geschicktes diplomatisches Taktieren zwischen Kaiser und Papst, deren Gegensätze er zu überbrücken vermochte.
In einer Podiumsdiskussion soll ein Vergleich zwischen dem Wirken des Deutschen Ordens im Südosten (Ungarn/Siebenbürgen) und im Nordosten (Preußen) versucht werden – wieweit spielten Missionierung und Kreuzzugsidee eine Rolle, welche Bedeutung kam der deutschen Siedlung und der Etablierung eines eigenen Staatswesens zu? Was waren in beiden Ländern die langfristigen Folgen? Relevanz für die Zeitgeschichte erlangte der Deutsche Orden durch das Bild, das sich die Neuzeit von ihm schuf – dieser bis heute nachwirkenden Rezeption soll eigens nachgegangen werden.
Termin
26. September 2011 • Berlin, Jacob- und-Wilhelm-Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität
Johannes Hevelius
Der Himmel über Danzig – Nachtleben und Nachleben eines Astronomen
Thementag
Eine Gedenktafel am Altstädtischen Rathaus in Danzig bezeichnet Johannes Hevelius (1611–1687) als »hervorragenden Gelehrten und Astronomen, Schöpfer des Himmelsatlas, Entdecker vieler Kometen und Sternbilder, genialen Konstrukteur und Erfinder, bekannten Danziger Brauer« – kurz: Er war der berühmteste Bürger Danzigs jener Zeit. Nach Studien in Leiden bereiste er vier Jahre lang England und Frankreich und legte dabei den Grundstein zu einem breiten Gelehrtennetzwerk. In Danzig übernahm er die Familienbrauerei und betrieb astronomische Studien, er wurde Stadtrat der Danziger Altstadt und schließlich deren Bürgermeister.
Hohes Ansehen erwarb sich Hevelius mit dem Buch Selenographie oder die Beschreibung des Mondes. Seine Sternwarte wurde weit über die Grenzen Danzigs hinaus bekannt. Gelehrte aus ganz Europa besuchten Hevelius in der Stadt an der Mottlau. In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit wurde Hevelius 1664 zum Mitglied der Royal Society in London ernannt.
Der aus einer evangelischen deutschen Familie stammende Hevelius wird wegen der damaligen politischen Zugehörigkeit seiner Heimatstadt – mit der Namensvariante Jan Heweliusz – auch als Pole bezeichnet. Damit ist er, wie viele Danziger Künstler und Wissenschaftler früherer Zeiten, Teil jener gemeinsamen Geschichte, die Polen und Deutsche verbindet. 2011 wird in Danzig als Johannes-Hevelius-Jahr begangen.
Termin
22. Oktober 2011 • Zeiss-Großplanetarium Berlin
E. T . A . Hoffmann
DurchFlug
Buchpräsentation
Dem Publikum vertieften Einblick in einen bisher wenig beachteten Aspekt aus dem Leben des weltberühmten Schriftstellers, Komponisten, Zeichners und Juristen E. T . A . Hoffmann zu gewähren, dazu gibt diese Buchpräsentationsreihe Gelegenheit. Im Gespräch gehen der Herausgeber und weitere Hoffmann-Experten den Besonderheiten der Hoffmannschen Aufenthalte in den »schönen romantischen Gegenden des Riesengebirges«, wie Hoffmann selbst schrieb, nach und betten sie in die bekannteren Lebensabschnitte dieses großen deutschen Romantikers ein.
Die schriftlichen Zeugnisse, die sich aus Hoffmanns Stationen in Schlesien erhalten haben, sind zunächst einmal seine privaten Briefe an den Jugendfreund Theodor Gottlieb von Hippel sowie zwei öffentliche Schreiben an den jeweiligen König. Von besonderem Reiz sind die Texte, die einen mehr oder weniger starken Schlesien-Bezug haben und der wechselvollen Geschichte dieser einmaligen Kulturlandschaft nachträglich ein bedeutendes Ruhmesblatt hinzufügen – wie die Jesuiterkirche von G. oder die Briefe aus den Bergen. Die Gesprächsrunde wird mit der Lesung eines dieser Texte abgeschlossen, um die von Hoffmann empfundene schlesische Aura erfahrbar zu machen.
Termine
31. März 2011 • Berlin, Volksbühne, Grüner Salon
25. Mai 2011 • Görlitz, Schlesisches Museum
21. September 2011 • Stuttgart, Haus der Heimat
9. November 2011 • Königswinter-Heisterbacherrott, Haus Schlesien
Daniel Ernst Jablonski
Brückenschläge im Europa der Frühaufklärung
Ausstellung
Daniel Ernst Jablonski (1660–1741) wirkte von 1693 bis zu seinem Tod als reformierter Hofprediger in Berlin und war zudem Bischof der Brüder-Unität in Polen. Sein Einfluss reichte jedoch weit über Preußen und Polen hinaus. Als Gelehrter, Wissenschaftsorganisator und Kulturpolitiker schlug Jablonski Brücken über territoriale Grenzen und konfessionelle Lager hinweg. Seine Ideen von Völkerverständigung, Toleranz und Bildung fielen im Europa der Frühaufklärung auf fruchtbaren Boden.
Zusammen mit Gottfried Wilhelm Leibniz gründete Jablonski 1700 in Berlin die erste Akademie der Wissenschaften in Deutschland. Seine Bildungsbemühungen sind ebenso modern wie sein Streben nach Gewaltverzicht, Minderheitenschutz und Ökumene. Sein auf Ausgleich und grenzüberschreitende Kommunikation zielendes Wirken macht ihn zu einem Symbol für die Herausforderungen der Gegenwart. Das Völker, Konfessionen und Kulturen verbindende, auf Ausgleich und Friedfertigkeit zielende Wirken Jablonskis macht ihn zu einem Vorbild für gegenwärtige politische Anliegen in Zeiten der EU-Osterweiterung.
Die Ausstellung veranschaulicht Jablonskis Wirken und das Europa der Frühaufklärung auf zwanzig Tafeln.
Termine
verlängert! bis 31. März 2011 • Berliner Dom
März bis April 2011 • Hannover, Leibnitz-Haus
9. bis 26. Juni 2011 • Herrnhut, Brüdergemeinde
2. bis 31. Juli 2011 • Niesky, Brüdergemeinde
22. Juli bis – 20. November 2011 • Prag, Pädagogisches Museum
7. August bis 30. September 2011 • Potsdam, Nikolaikirche
24. Oktober bis 12. Dezember 2011 • Frankfurt/O., Viadrina, Gräfin-Dönhoff- Gebäude
August von Kotzebue
Wie unterhaltend darf ein Schriftsteller sein?
Lesung
August von Kotzebue (1761–1819), einer der erfolgreichsten Schriftsteller seiner Zeit, orientierte sich lebenslang auf das östliche Europa. In Weimar geboren, kam er durch Heirat nach Estland und trat in russische Dienste. Als Theatermann in Königsberg, St. Petersburg und Reval (heute Tallinn) war er ein wichtiger Vertreter des deutschen Theaters und der deutschen Literatur in dieser Region.
In vielen seiner überaus erfolgreichen Dramen, die auf allen deutschsprachigen Theatern mit riesigem Erfolg gespielt wurden, brachte er osteuropäische historische Themen auf die Bühne. Trotz seiner großen Beliebtheit unter den Zeitgenossen ist Kotzebues literarisches Werk heute weitgehend vergessen. Grund hierfür ist die Rolle des politisch immer sehr anpassungsfähigen Schriftstellers in russischen Diensten, die Kotzebue vor allem für die deutschen national gesinnten Studenten verhasst machte. 1819 wurde Kotzebue in Mannheim von dem Theologiestudenten Ludwig Sand ermordet.
In seinem seinerzeit Aufsehen erregenden Buch Das merkwürdigste Jahr meines Lebens (1801) erzählt Kotzebue von seiner auf einem Missverständnis beruhenden Verhaftung in Russland im Jahr 1800 und der nachfolgenden kurzen Verbannung nach Sibirien.
Die Lesung aus diesem Buch eröffnet nicht nur eindrucksvolle Perspektiven auf die geschilderten Verhältnisse in Russland, sondern auch auf die Praxis der politischen Literatur um 1800 zwischen Selbstbehauptung und Unterwürfigkeit. Lesung mit Einführung und Kommentar
Termine
Dienstag, 3. Mai 2011 • Weimar, Eckermann-Buchhandlung
Fanny Lewald
Eine emanzipierte Schriftstellerin aus Königsberg
Lesung
Fanny Lewald (1811–1889), in einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Königsberg geboren, ist eine der wichtigsten deutschen Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts. Auf dem langen Weg zur Anerkennung als Schriftstellerin hatte sie zahlreiche Widerstände zu überwinden. Erst im Alter von dreißig Jahren konnte sie an die literarische Öffentlichkeit treten, zunächst mit anonymen Beiträgen aus Königsberg in der Stuttgarter Zeitschrift Europa, die ihr Onkel August Lewald redigierte. Es folgten zahlreiche Romane und Aufsätze zu politischen und sozialen Zeitfragen, die auch heute noch lesenswert sind.
Fanny Lewald war sich ihrer emanzipatorischen Vorreiterrolle durchaus bewusst, und sicher war dies auch ein wichtiges Motiv für die Niederschrift ihrer Erinnerungen, die unter dem Titel Meine Lebensgeschichte in den Jahren 1861–1862 in drei Bänden erschienen. Diese literarischen Memoiren zeichnen ein Leben nach, das von der Kindheit und Jugend auf dem Kneiphof in Königsberg über die Berliner Jahre mit Aufenthalten in Schlesien die Geschichte der Emanzipation einer jüdischen Frau in Preußen erzählt. Eine große Rolle spielen hier auch die vielen bedeutenden Zeitgenossen, denen Fanny Lewald in ihrem langen Leben begegnete.
Lesung mit Einführung und Kommentar
Termine 2012
Dienstag, 24. Januar 2012 • Weimar, Kirms-Krackow-Haus
Mittwoch, 25. Januar 2012 • Stuttgart, Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg
Donnerstag, 26. Januar 2012 • Düsseldorf, Gerhart-Hauptmann-Haus
Termine
Mittwoch, 18. Mai 2011 • Lüneburg, Ostpreußisches Landesmuseum
Dienstag, 18. Oktober 2011 • Berlin, Grüner Salon in der Volksbühne
Martin Opitz
Wieder entdeckt
Lesung und Gespräch
Geboren 1597 in Bunzlau, dem heutigen Bolesławiec in Polen, spannte Martin Opitz’ Lebensweg einen Raum zwischen den Niederlanden und Pommerellen, zwischen Jütland und Siebenbürgen auf. Seine Schulbildung erfuhr er in Breslau und Beuthen an der Oder (heute Bytom Odrzański), ging als Hauslehrer nach Frankfurt (Oder), studierte in Heidelberg Philosophie und Jura und war während des Dreißigjährigen Krieges zeitweilig als Hauslehrer in den Niederlande tätig.
Später lehrte er auf Einladung des Fürsten Gabriel Bethlen im siebenbürgischen Weißenburg (rumänisch Alba Iulia) und veröffentlichte 1624, nach Breslau zurückgekehrt und als Rat am Hof des Grafen von Liegnitz beschäftigt, sein Hauptwerk, das Buch von der deutschen Poeterey. Als Sekretär und Historiograph im Dienst des polnischen Königs, Władysław IV. Wasa, ließ er sich in Danzig nieder, wo er 1639 starb. Seine Grabstätte befindet sich in der Danziger Marienkirche. Opitz’ Beitrag zur Begründung der deutschen Barockliteratur brachte ihm die ehrenvolle Bezeichnung »Vater der deutschen Dichtkunst« ein.
Im Gespräch über und mit »Poeterey« illustriert unter anderem der Lyriker und Schriftsteller Michael Lenz (Ingeborg-Bachmann- Preis 2008), wie aktuell Opitz’ Werk noch heute ist.
Termin
Dienstag, 12. April 2011 • Berlin, Literaturwerkstatt
Donnerstag, 15. September 2011 • Herne, Martin-Opitz-Bibliothek
Anton von Radziwill
Politiker und Musiker, Pole und Preuße
Konzert
Fürst Anton von Radziwill (1775–1833) entstammt einer der reichsten und einflussreichsten Adelsfamilien des östlichen Europa. In Wilna geboren, studierte er in Göttingen und kam in den 1790er Jahren an den preußischen Königshof. 1796 heiratete er die preußische Prinzessin Louise Friederike, die geliebte Schwester des komponierenden Prinzen Louis Ferdinand. Lebenslang setzte sich der Fürst für die Wiederaufrichtung Polens ein, allerdings in Personalunion mit Preußen, was unter vielen seiner polnischen Landsleute keine Zustimmung fand.
Neben seiner großen Bedeutung als Politiker und Diplomat ging der Name des Fürsten Radziwill auch in die Musikgeschichte ein, und zwar als Komponist und als Mäzen. Radziwills Faust-Musik, ein abendfüllendes Oratorium, gilt als eine der ersten Vertonungen des Goetheschen Dramas überhaupt. Radziwill war ein Förderer nicht nur seines berühmten Schwagers Louis Ferdinand von Preußen, sondern auch des jungen Frédéric Chopin, der in seinem Haus in Posen verkehrte und ihm sein Klaviertrio op. 8 widmete.
In dem moderierten Konzert erklingen Werke von Anton von Radziwill gemeinsam mit Kompositionen von Louis Ferdinand von Preußen und Frédéric Chopin, gespielt auf Musikinstrumenten der Zeit.
Termine
Donnerstag, 16. Juni 2011 • Berlin, Schloss Friedrichsfelde
Anton Ferdinand Titz und Anton Eberl
Quartette für den Zaren Alexander
Konzert
Der Musikerberuf gehört in der Kulturgeschichte zu den Tätigkeitsfeldern, die besonders durch Mobilität und übernationalen Austausch ausgezeichnet sind. St. Petersburg, die prächtige Residenz des aufstrebenden russischen Kaiserreiches, war im 18. und 19. Jahrhundert eine besonders attraktive Station für reisende Virtuosen. Am Hofe Katharinas der Großen hatten neben vielen Italienern auch zahlreiche Instrumentalisten aus den deutschsprachigen Ländern Anstellungen gefunden.
Der »geniale Sonderling« Anton Ferdinand Titz (gest. 1810), der Begründer der Kammermusikpflege in Russland, war in den 1790er Jahren Violinlehrer des Thronfolgers Alexander Pawlowitsch. Als der musikalische Kronprinz im Jahre 1801 zum Kaiser Alexander I. gekrönt wurde, setzte eine ganze Welle von musikalischen Widmungen ein: Zu den bekanntesten Werken, die Alexander I. gewidmet wurden, gehören Ludwig van Beethovens Violinsonaten op. 30 aus dem Jahre 1802. Auch Anton Eberl (1765–1807), ein heute zu Unrecht weitgehend vergessener Zeitgenosse Beethovens, hat für den Petersburger Hof, an dem er bereits in den 1790er Jahren gearbeitet hatte, komponiert.
In dem Konzert werden Streichquartette von Titz und Eberl aufgeführt, die im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts in St. Petersburg entstanden.
Moderiertes Konzert mit dem Hoffmeister-Quartett auf historischen Instrumenten
Johannes Urzidil
Hinternational
Buchpräsentation
Johannes Urzidil (1896–1970), jüngster Dichter des berühmten »Prager Kreises« um Max Brod, Franz Kafka und Franz Werfel, hat als Sohn einer deutsch-tschechisch-jüdischen Familie eine Biografie nicht eindeutiger nationaler Zugehörigkeiten, wie sie für das östliche Mitteleuropa typisch ist. Nach der Besetzung Prags durch die Nationalsozialisten emigrierte Urzidil nach New York und nahm später die amerikanische Staatsangehörigkeit an. Der Brückenschlag zwischen alter und neuer Heimat wurde für den Sohn eines deutschnationalen Vaters und einer tschechisch- jüdischen Mutter zu einem Leitmotiv seines Lebens und Schreibens. In Urzidils Hauptwerken Goethe in Böhmen, Die verlorene Geliebte und Prager Triptychon steht seine alte Heimat im Mittelpunkt. Er schrieb aber mit das große Halleluja auch einen bedeutenden Amerika-Roman.
Zum 40. Todestag des Dichters erschien in der Potsdamer Bibliothek östliches Europa die Publikation HinterNational – Johannes Urzidil. Ein Lesebuch von Klaus Johann und Vera Schneider. Das Buch wird in Form eines multimedialen Vortrags präsentiert, bei dem Tondokumente zu Gehör gebracht und zahlreiche Bilder mit biografischen Bezügen gezeigt werden.
Termine 2012
Mittwoch, 25. Januar 2012 • Wien, Tschechisches Zentrum
Donnerstag, 26. Januar 2012 • Linz, StifterHaus
Freitag, 27. Januar 2012 • Salzburg, Stefan Zweig Centre
Termine
Dienstag, 22. Februar 2011 • Berlin, Tschechische Botschaft
Freitag, 18. März 2011 • Leipzig, Buchmesse
Freitag, 1. April 2011 • Bansin (Usedom), Hans-Werner-Richter-Haus
Dienstag, 12. April 2011 • Brünn, Mährische Landesbiliothek
Mittwoch, 13. April 2011 • Olmütz, Universität
Dienstag, 10. Mai 2011 • Budapest, ELTE, Germanistisches Institut
Montag, 16. Mai 2011 • Freiburg, Johannes-Künzig-Institut
Freitag, 1. Juli 2011 • Goch, Collegium Augustinianum Gaesdonck
Donnerstag, 15. September 2011 • Bremen, Buchhandlung Leuwer
Sonnabend, 8. Oktober 2011 • Oeverse, Akademie Sankelmark
Dienstag, 11. Oktober 2011 • Pilsen, Westböhmische Universität
Mittwoch, 12. Oktober 2011 • Budweis, Südböhmische wissenschaftliche Bibliothek
Donnerstag, 29. Dezember 2011 • Bad Kissingen, Der Heiligenhof