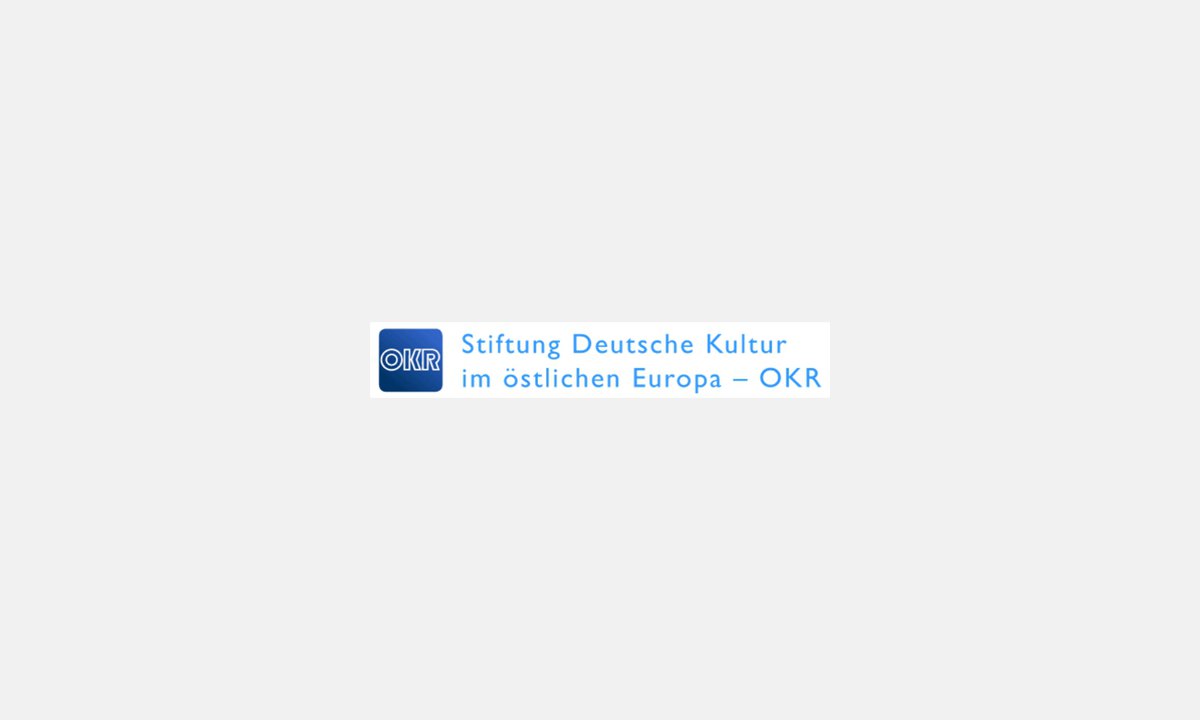Dies ist keine Buchbesprechung. Es ist eine Vermisstenanzeige. Vermisst werden Sprach- und Sachkenntnis sowie literarischer Geschmack. Ausreichend vorhanden sind Unkenntnis, Geschäftstüchtigkeit und Werbewirbel. Damit wird einem Lesepublikum vorgemacht, seine vermutlich düsteren Vorstellungen von Ost- und Südosteuropa in jüngster Vergangenheit bis Gegenwart träfen zu, wo sie sich doch mit denen einer jungen aufgeklärten Autorin decken, die so oberflächlich wie feierlich rezensiert, auf der SWR-Bestenliste geführt und für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert worden ist. So muss es kommen, wenn Ignoranz in Gefühligkeit und dazugehörige Duselei umschlägt.
Wissen hat noch nie geschadet, auch nicht beim Bücherschreiben. Muss man aber wissen, dass die deutschen Ordensritter in Siebenbürgen mit der Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen nichts zu tun haben, oder dass sächsische Kaufleute seinerzeit auch mit Orientteppichen gehandelt und einige davon ihrer Heimatkirche, etwa der Kronstädter Schwarzen Kirche, gestiftet haben? Nein, das muss man nicht, es sei denn, man schreibt ein Buch darüber.
Nun hat Ursula Ackrill zwar kein Buch darüber, aber darüber in einem Buch geschrieben, das von den Siebenbürger Sachsen handelt. Die Teppiche seien »Trophäen von gedemütigten Kriegsherren des Sultanats«. Wer hat sie gedemütigt, etwa die sächsischen Kauf- und Fuhrleute? Mehr noch: »Die Schwarzburg auf dem Zeidner Berg war vom Deutschen Ritterorden den Sachsen zur Wehr gebaut worden. Die Ritter kamen zum Schutz der Sachsen an die Grenzmark des Ungarlands. Sie bauten Burgen und führten Krieg gegen alle, die sie bedrohten.« Weder stand die Schwarzburg auf dem Zeidner Berg, noch führten die Ritter Krieg gegen alle, sie versuchten schlicht zu bestehen, bis ihre Eigenständigkeit dem ungarischen König zuviel wurde und er deutsche Bauern ins Land holte.
Man mag sagen, dies ist ein Roman, und da darf man seiner Vorstellung freien Lauf lassen, auch in die Irre. Nur ist dies ein Roman, in dem Zeitgeschichte befragt und beurteilt wird. Die Zeitgeschichte aber, jene des Januars 1941, speziell im siebenbürgischen Zeiden, ist die Geschichte des siebenbürgisch-sächsischen Versagens vor der nazideutschen Versuchung. Und hier wird es schwierig und schwer, bedeutungsschwer, denn in diesem Zwielicht sind das nicht schlicht Fehlinformationen, sie werden umgedeutet zu Symptomen, zu orakelhaften Zeichen der Anfälligkeit auch schon jener Proto-Sachsen für kriegerisches Gehabe – die sie nun, 1941, dem kriegerischen Deutschen Reich in die Arme treibt. Denn der historisch namhafte sächsische Obernazi Andreas
»Schmidt schmeichelt und wirbt: ›Ursprünglich begleiteten uns Deutschritter auf unserer Einwanderung … Zwar wurden die Deutschritter aus Siebenbürgen herauskommandiert, ich weiß, man kann es so sehen, dass sie uns im entscheidenden Moment vor dem Mongolensturm im Stich gelassen haben …‘, sein Blick sucht in der Dunkelheit den Zweifel auf Leontines Stirn, ›aber: Haben wir nicht von ihnen gelernt, unsere Wehrburgen zu bauen, die nun im Zentrum jeder Sachsensiedlung stehen?‹«
Nicht nur »schlängelt sich Andreas Schmidt wie eine neue Autobahn von Siebenbürgen nach Deutschland« er lügt natürlich noch dazu wie jeder Propagandist. Besorgnis erregt nur: Er lügt, als hätte er Ursula Ackrill gelesen.
Hier passiert es: Eine Autorin stellt sich mit ihrer Unkenntnis einem Nazi mit seiner Propaganda zur Seite. Dabei ist sie, guten Willens und Mutes, mit epischem Bemühen darauf aus, zu zeigen, wie die Sachsen nicht nur Zeidens auf die nationalsozialistische Demagogie hereinfielen – fällt aber gewissermaßen selbst darauf herein. Was sie den ominösen Andreas Schmidt da, auf Seite 231 des Buches, in einer Zeidner Versammlung tönen lässt, hat sie auf Seite 109, siehe oben, selbst sanktioniert. Geschichte hat, genau wie Recht, der, dem sie/es gegeben wird. Ursula Ackrill gibt, soviel sie eben kann.
Zwischen Zeiden und Bukarest spinnt sie ein Netz der Mutmaßungen, in dessen Mittelpunkt jene Leontine mit dem Zweifel auf der Stirn sitzt, eine Sächsin, die nazi-sächsisch nicht sein will (»Wir Sachsen leben auf dem Mond«) und mit ihren guten Gründen nicht hinterm – Zeidner – Berg hält. »Unser Vermodern in den eigenen Burgen in der Zuversicht, dass sich alles zum Guten wenden wird, ist eine elende Lage. Politisch sind wir ein Hurenhaus, werfen uns an den Hals von jeder Partei, die gerade das Sagen in der Regierung hat.« Ob nun »Vermodern« eine »Lage« und wie man »politisch ein Hurenhaus« ist, mag als Stilfrage abgetan werden, jedenfalls haben die Sachsen längst kläglicher versagt als dieser Stil: »Als Siebenbürgen im 19. Jahrhundert das Mittelalter zurückließ, hätten die Notablen eine andere Platte auflegen sollen. Eine starke Wirtschaft antreiben, auf deren Überfluss der Flor der Künste seine Filamente zwischen Himmel und Erde zieht, schemenhaft wie eine Kultur Penizillin auf Obstschalen.« Obstschalen mag es im 19. Jahrhundert ja in Fülle gegeben haben, aber »Flor« mit »Filamente(n)« kaum, und Penizillin oder Platten zum Auflegen schon gar nicht. Auch poetischer Überschwang darf sich nicht über reale Zusammenhänge hinwegsetzen.
Dennoch: Ursula Ackrill ist eine Dichterin. Sie kann sagen: »windstill, der Himmel lag eng an. Maria erkannte den Augenblick der Gnade vor dem Schneefall«, man liest es und dankt gern für die Gnade. Oder: »Inzwischen hat sich der Himmel in alle Richtungen vergilbt, das Licht in Dünen und Bänken geschichtet, die Sonne selbst eine graue Perle in bleichem Austernfleisch«, und dem Leser geht ein Licht auf. Oder: »Die Wolke ist aufgestiegen und hat eine matte stahlgraue Leere hinterlassen.«
Hoffnungsfroh stimmt einen dieser dichterische Schwung, manch eine/einer, auch aus Siebenbürgen, gar aus Zeiden, mag sich wiederfinden in diesen Bildern. Aber gerade deshalb hätte Ursula Ackrill einen anderen Lektor vulgo Leser verdient, und zwar vor der Veröffentlichung ihres Textes. Aus Siebenbürgen hätte sie/er nicht sein müssen, auch nicht sein sollen, die Kenntnis der deutschen Sprache hätte ausgereicht.
Es ist schnöde, eine junge Autorin mit den Tomaten zu bewerfen, die ihr Verlagslektorat (sofern es eines gegeben hat) und diverse Rezensenten (aller großen Zeitungen) und Juroren (SWR-Bestenliste, Leipziger Buchpreis) auf den Augen haben. Ein editorisches Fiasko ist das Buch, und der honorige Verlag Klaus Wagenbach hat sich – die Parodie auf Ackrill sei erlaubt – mit Unruhm bekleckert. Was »klapsmühlenreif und entzückend«, was eine »Schippennahme« sein mag, derlei kann der Rezensent leichthin, nun ja, auf die Schippe nehmen. Aber dass jemand, dazu noch »einarmig«, an der »Regenrinne« hängt, wo es doch das Regenrohr ist, dass der Eisenbahner gegen »Puffer« hämmert, wo es doch die Räder sind, dass Gemsen »Füße« und Mädchen »dampfende Schamberge« angedichtet werden, dass Kinder »Augen machten wie ein Pfauenschwanz«, jemand »von schallendem Gelächter umwogen« ist und Fensterscheiben »angeschlagen« statt beschlagen sind, dass »Zirptöne« sanft »rollen« und eine Zeidner »Mutter mit geweiteten Nüstern die Witterung unbeanstandet gebliebener Frevel im Raum aufnahm« und zur sittlichen Ermahnung »in einem schorrenden, Rücksichtnahme vortäuschenden Selbstgespräch fortfuhr: ›und wenn es euch im Arsch juckt, steckt euch einen Krautstrunk rein und zieht euch einen Sack Kartoffeln auf den Bauch‹« – das sind nur einige der Wegmarken hinauf zum Gipfel sprachlichen Unvermögens.
Stehende Wendungen werden permanent und penetrant falsch ausgeführt, jemand »geriert sich zum Zollbeamten«, etwas ist jemandem »widerlich« statt zuwider, wieder ein anderer »sprang auf die Beine«, Juden in Not sind »notgedrungene Juden«, unter ihnen gibt es Ärzte, die nicht zum, sondern »den Großteil ihrer Praxen verloren, als sie nur noch jüdische Patienten verarzten durften«, ein Veitstanz wird »vollbracht« statt vollführt, ja in Freck hält »Brukenthals Geist« dergestalt Hof, dass die Frage danach nicht nur bang, sondern auch falsch ausfällt: »Was spukt denn um?« Wenn es spukt, geht etwas um, etwas wie »umspuken« aber geht nicht. Dass dazu noch die Tempora der Verben ständig ins Schlingern geraten, dass innerer Monolog, erlebte Rede und auktoriale Erzählung dauernd ineinanderschwappen, das ergibt einen Text, den ein Karl-May-Fan für modern und deshalb kraus halten und nicht lesen mag, wer ihn aber lesen will, dem verlangt er einiges an Fehlertoleranz ab.
Auf dass er mit Ursula Ackrill und ihrer Protagonistin Leontine erkenne, wo bei den Sachsen der (Lind-)Wurm drin war: »Es war ein prekärer leisetreterischer behutsamer Gruppentanz, präzise geregelt wie (ein) Uhrwerk, das rückwärts läuft, mit dem man als Gemeinschaft gerade noch über die Runden kam. Um die Jahrhundertwende hatten sie sich in eine Zeit größerer Stabilität hinübergerettet. Sie konnten aus ihrem Gehäuse herausschlüpfen und vorwärtsgleiten. Doch etwas hatte sich in dieser mageren Zeit an die Sachsen geheftet. Ein Lindenblatt am Rücken. Ein Faden zog sich durch die eingestickten Kreuze auf ihren Gewändern und hielt sie zusammen.« Wieder soll mit einer Anspielung, diesmal auf die Nibelungen, das unaufhaltsame Verderben herbeiassoziiert werden, aber sächsischer Trachtenkreuzstich und das fatale Kreuz Krimhilds auf Siegfrieds Rücken, diesen jedes Vorstellungsvermögen überdehnenden Spagat macht der Autorin so leicht niemand nach.
Der in den Widrigkeiten der Geschichte gewachsenen »Eintracht durch Zusammenarbeit« zollt Ackrill bei aller Kritik durch ihre – im Wortsinn – Heldin Leontine ihren Respekt, ruft aber das historische Personal Zeidens in den Zeugenstand jenes Gerichtstags, den man laut Ibsen beim Schreiben hält – über sich. Viel wird erzählt in diesem Buch, Orte und Tage und Jahre werden heraufbeschworen, die Deutschen Südosteuropas leisten den Offenbarungseid. Im Januar 1941 geben sie ihr teuerstes Gut, die selbstgeschaffene Eigenständigkeit, auf und sich in die Hand derer, die Verderben über die Welt bringen. Schon hat der Auschwitzapotheker Capesius seinen unheilschwangeren Auftritt in Zeiden, schon telefoniert Andreas Schmidt von hier mit dem Bukarester Faschistenführer Horia (Sima) über das dortige Judenpogrom. Hier wird erzählerisch getrickst, dass von der Erzählung nur noch die Absicht übrigbleibt. Der böse Hauch der Weltgeschichte weht durchs Buch, wahrnehmen kann ihn allerdings nur, wer begnadet ist wie die Autorin und ihre Leontine, denn die »wusste, verflixt und zugenäht, sie wusste Bescheid«.
Ursula Ackrill scheut sich nicht, Klarnamen und Charakterdefizite offenzulegen, ja tiefenpsychologisch mit erotischer Verklemmtheit in Bezug zu setzen. Der – ebenfalls beurkundete – Triebmörder Balan, der die Sächsin Rosa aus dem Waldbad entführt hat, wird zum sinistren Bannerträger schwüler Zeidner Männerphantasien: »Ein Fieberwahn war in jenem Sommer unter den Männern ausgebrochen. Ein kollektiver Impuls belegte Rosas Gestalt mit orgastischem Beschlag: Perplex entdeckte man, dass man beim Ejakulieren blitzartig Rosa beschwörte.« Perplex entdeckt man auch hier: Kein Tobak, aber stark – und falsch, nicht nur in der Konjugation des Verbs »beschwören«, dessen Präteritum »beschwor« heißt.
Dass jemand schlecht schreibt, ist normal, auf Deutsch sowieso. Diese Autorin schreibt nicht schlecht, sie schreibt mit dem hitzigen Bemühen um Originalität, und sie hätte verdient, dass ihr jemand vom Fach stilistische Verwegenheit und formulatorisches Imponiergehabe ausredet. Eine Wachslache ist nicht schlicht eine solche, sondern eine, »in die sich eine Kerze übergeben hatte«, eine Glocke klingt nicht einfach aus, sondern »komisch, wie wenn der Herrgott gefurzt hätte«, und leidenschaftlich aggressiver Geschlechtsverkehr hat zur Folge, »dass die Fetzen flogen und ihre Schnittstellen wie zerrittene Pferde schäumten«. Eine Mutter, »die, wie Marlene Dietrich auf Liebe, von Kopf bis Fuß auf die Kinder eingestellt gewesen war«, ein Vater, der »ein Stück Jugendstil stillgelegt« hat, das sind angestrengte Spielchen, die einem pubertären Schulaufsatz zur Ehre gereichen mögen. Aber das »generelle Mondkälbertum« der Sachsen ist dann doch allzu mond- und kälber- und tumhaft, dazu auch noch »generell«. Shakespeare oder Morgenstern wäre das – wieder parodiere ich freiwillig die unfreiwillige Parodie – wohl »klapsmühlenreif« erschienen.
Ernst ist Ursula Ackrills Ansinnen, Zeiden, im Januar und die Nazivergangenheit der Sachsen Roman werden zu lassen. Es hätte nicht kompromittiert werden dürfen durch schlechterdings lustige Stilblüten traurigster Qualität: »Zornig schlüpfte Maria ihr Kleidchen über.« Selbst der Völkchensverdummer und -führer Andreas Schmidt erfährt in blütenreichstem Stil Weihen just von der venezianischen Lagune: »Gewachsen ist er wie ein Bauer. Sie sieht seine Schaufelhände und breiten Füße, vom Umspannen der Erdschollen hinterm Pflug gespreizt, aber seine Beckenknochen sind Geschmeide aus Murano(,) und er führt mit den Hüften.«
Vor derlei Geschmeide hätte Ursula Ackrill bewahrt werden müssen. Einen nächsten Versuch wäre es wert.
Ursula Ackrill: Zeiden, im Januar. Roman. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2014, 255 Seiten
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Kulturpolitischen Korrespondenz